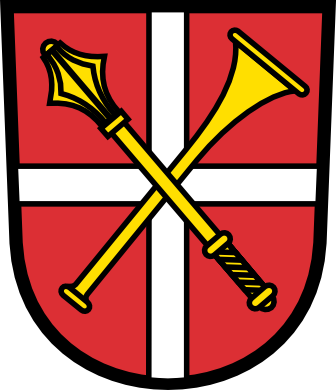Pubblicazioni
La nostra principale pubblicazione si presenta regolarmente:
Archivio Araldico Svizzero
Archivum Heraldicum
ISSN: 1423-0534
Open Access
Gli autori hanno immediatamente il diritto di disporre liberamente del PDF del loro articolo. Tuttavia, in accordo con la politica del Green Open Access, ci sarà un periodo di embargo di 12 mesi per l'intera edizione. Da quel momento in poi, l'intera edizione sarà disponibile anche su e-periodica.
2020
Bäuerliche Herrschaftsheraldik in St. Stephanus, Genhofen, Kreis Lindau / Bayrisch Schwaben - Horst Boxler
Ein herausragendes Kleinod und in Teilen zum UNESCO-Weltkulturerbe zählend findet sich in der spätgotischen Kirche St. Stephanus zu Genhofen, zur Gemeinde Stiefenhofen im Kreis Lindau, Bayrisch Schwaben, gehörend, ein Fresken-Ensemble, das insofern als „Bäuerliche Herrschaftsheraldik“ bezeichnet werden kann, als die Maler über Jahrhunderte den Farb- und Malstil ihrer heimatlichen Bauernhäuser in die Kirche übertragen haben. Ausserdem haben diese Unbekannten hier mannigfache heraldische Zeichen ihrer Heimatherrschaften verewigt, gleichzeitig aber auch den Wechsel der Zeiten für Genhofen und Umgebung dokumentiert. Eine besondere Herausforderung zeigte sich in der Bestimmung der Wappen, die nicht immer in idealer Weise abgebildet wurden und sicher häufiger rein aus der Erinnerung gestaltet wurden. Zusätzlich bieten die Fresken in Langhaus und Chorraum ein wunderbares Zeugnis der jahrhundertealten Volksfrömmigkeit mit der Heilsgeschichte und mannigfachen Legenden, um den noch schriftlosen Gläubigen wie nicht anders in grösseren und bedeutenderen Kirchen das Leben Jesu und die Versprechen der Eucharistie näherzubringen.(Horst Boxler)
Über das Siegel von Guillaume de Beaujeu, Meister des Tempels - Jean-Bernard de Vaivre
Als angekündigte und erwartete Ergänzung zu einer Mitteilung des Autors, die durch eine voreilige Veröffentlichung unbeabsichtigterweise publik wurde (1963), vergleicht die vorliegende Studie die Wappensiegel von zwei der zahlreichen Beaujeu-Familien, die im Mittelalter in Frankreich verzeichnet waren. Die der Grafschaft Burgund (Franche Comté) und die aus dem Forez und der Auvergne, denen die Herkunft des Templermeisters Guillaume de Beaujeu ohne entscheidende Argumente abwechselnd zugeschrieben wurde. Er wurde 1273 gewählt und 1291 bei der Belagerung von Akkon getötet, welche das Ende der Kreuzfahrer im Heiligen Land bedeutete.
In den Siegeln der Beaujeu aus dem Forez und der Auvergne erscheint, mit verschiedenen Varianten und oft mit einem Turnierkragen, ein steigender Löwe auf einem mit Schindeln besäten Feld. Nur wenige Meister militärischer Orden benutzten im 13. Jahrhundert Siegel mit ihrem persönlichen Wappen. Die von Guillaume de Beaujeu sind jedoch bekannt.
Er benutzte ein privates Gegensiegel auf der Rückseite des großen Tempelsiegels auf einem einzigartigen erhaltenen Dokument, einer Urkunde von 1286, die von direktem Interesse für die Geschichte des Heiligen Landes ist. Der Löwe auf einem mit Schindeln besäten Feld ist darin prominent vertreten. Nun, in den Wappen der Beaujeu aus der Franche Comté, mit der manche Leute Guillaume schon lange in Verbindung bringen wollen, findet sich jedoch kein Löwe. Letztere trugen ein durchgehendes Kreuz, bewinkelt mit Schindeln in unterschiedlicher Anzahl. Da der Fall bezüglich des Wappens der Beaujeu im Allgemeinen falsch behandelt wurde, läuft die hier gebührend begründete Schlussfolgerung darauf hinaus Guillaume de Beaujeu, den Meister des Tempels, der Familie aus der Auvergne zuzuschreiben. (Gaëtan Cassina, Übers. Rolf Kälin)
In den Siegeln der Beaujeu aus dem Forez und der Auvergne erscheint, mit verschiedenen Varianten und oft mit einem Turnierkragen, ein steigender Löwe auf einem mit Schindeln besäten Feld. Nur wenige Meister militärischer Orden benutzten im 13. Jahrhundert Siegel mit ihrem persönlichen Wappen. Die von Guillaume de Beaujeu sind jedoch bekannt.
Er benutzte ein privates Gegensiegel auf der Rückseite des großen Tempelsiegels auf einem einzigartigen erhaltenen Dokument, einer Urkunde von 1286, die von direktem Interesse für die Geschichte des Heiligen Landes ist. Der Löwe auf einem mit Schindeln besäten Feld ist darin prominent vertreten. Nun, in den Wappen der Beaujeu aus der Franche Comté, mit der manche Leute Guillaume schon lange in Verbindung bringen wollen, findet sich jedoch kein Löwe. Letztere trugen ein durchgehendes Kreuz, bewinkelt mit Schindeln in unterschiedlicher Anzahl. Da der Fall bezüglich des Wappens der Beaujeu im Allgemeinen falsch behandelt wurde, läuft die hier gebührend begründete Schlussfolgerung darauf hinaus Guillaume de Beaujeu, den Meister des Tempels, der Familie aus der Auvergne zuzuschreiben. (Gaëtan Cassina, Übers. Rolf Kälin)
Siegel des Jean d’Épône, Prior von Évière - Jean-Bernard de Vaivre
Der Mönch der Benediktinerabtei der Dreifaltigkeit von Vendôme, Jean d’Épône, besaß ein wunderschönes Siegel, von dem das heute gestohlene Typar die Jahrhunderte überlebt hatte. Der hier abgebildete Abguss zeigt die hohe künstlerische Qualität der Dekoration und die Legende besagt, dass Jean d’Épône Prior von Evière war, einem Benediktinerpriorat, das von der Dreifaltigkeitsabtei von Vendôme abhängig war und den Mönchen von Vendôme als Zufluchtsort im Anjou dienen sollte. Die 1694 veröffentlichte Ansicht ist das einzige Zeugnis dieser 1047 gegründeten, 1131 abgebrannten, im 15. Jahrhundert ersetzten und im 17. Jahrhundert vollendeten Einrichtung, von der nichts mehr erhalten ist. Der promovierte Jurist Jean d’Épône ist durch einen Text in den Geheimarchiven des Vatikans bekannt, eine Bulle, die am 6. Mai 1370 seine Ernennung zum Oberhaupt des Priorats Évière in Angers bestätigt. Die Herstellung des Typars liegt also zeitlich nach diesem Datum. (Gaëtan Cassina, Übers. Rolf Kälin)
Kaminplatte von 1594 aus L’Abbaye mit dem Wappen von Pierre Berney (Vallée de Joux, VD) - Pierre-Yves Favez
Der Autor wurde gebeten, den Träger des Wappens zu identifizieren, das auf einer Kaminplatte angebracht ist, die derzeit an der Fassade des Hauses «Grand-Toit» in Le Pont (Vallée de Joux, VD) angebracht ist. Sie trägt die Jahrzahl 1594 und einen Schild mit einem Ochsen- oder Stierenkopf, zwischen dessen Hörnern sich ein fünfstrahliger Stern befindet, und ist mit den Initialen P und B versehen. Das Datum und die Initialen haben die Suche auf die Spur der Bertet oder Berthet alias Berney gebracht. Bisher waren für diese Familie nur sehr unterschiedliche und viel jüngere Wappen bekannt (1797, um 1800, 1857). Die Initiale des Vornamens entspricht Pierre, der einen Besitz geerbt hatte, insbesondere ein Haus in L’Abbaye und nicht in Le Pont. Für dieses Haus, das seit der Ansiedlung der Familie Berney in L’Abbaye im Jahr 1492 das Zuhause der Familie ist, wurde die Kaminplatte 1594 sicherlich hergestellt. Der Umzug in das Haus «Grand-Toit» in Le Pont, ein langjähriges Anwesen der Rochat, könnte das Ergebnis einer Ehe Rochat-Berney zu einem unbestimmten Zeitpunkt gewesen sein. Die Familie Berney hatte die Erinnerung an ihr ursprüngliches Wappen, das durch diese eine Kaminplatte bezeugt wird, nicht bewahrt, weshalb gegen 1800 neue Wappen geschaffen werden mussten.(Gaëtan Cassina, Übers. Rolf Kälin)
Der heraldische Schlüssel zum Tabernakelsekretär im Staatsarchiv St. Gallen - Benno Hägeli
Der am Empfang im Staatsarchiv St. Gallen platzierte Tabernakelsekretär aus der früheren Fürstabtei wirft insbesondere die Frage nach dessen Besitzer auf. In der Fachliteratur bei Erwin Poeschel, Bernhard Anderes und Josef Grünenfelder findet man theologische Beschreibungen zweier Intarsienbilder, doch konnte man den Sekretär bis anhin keinem Besitzer zuordnen. Eine nähere Analyse der Szene auf dem Türchen in der Sitznische ergibt, dass es sich um eine bildliche Darstellung des Wappens von Fürstabt Coelestin Gugger (28. Juni 1701-24. Febr. 1767), dem Erbauer der St. Galler Stiftskirche, handelt. Als Beweis können der Wappenbrief sowie Beilagen in Schrift und Bild zu einem Briefwechsel zwischen Fürstabt und dessen Schwager herangezogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass das guggersche Wappen in der heraldischen Fachliteratur mehrheitlich falsch wiedergegeben wurde. Der Sekretär muss folglich nach 1740, dem Jahr des Amtsantritts des Fürstabts, entstanden sein. Die Frage nach dem Künstler bleibt leider noch ungelöst.(Benno Hägeli)
Das Wappenbuch der Schildnerschaft der Gilde der Zürcher Heraldiker - Rolf Kälin
Am 1. August 1930 fand in Zürich durch eine Gruppe jüngerer Zürcher Freunde der Wappenkunst die Gründung einer heraldischen Gesellschaft, der «Gilde der Zürcher Heraldiker», statt. Ein gutes Jahrzehnt später, gemäss Beschlüssen vom 13. November 1941, wurde dann auf das Hauptbott 1942 ein Wappenbuch der Schildnerschaft angelegt. Erster Wappenkünstler war Schildner Jakob Suter. Auf ihn folgten weitere bekannte Wappenkünstler wie Paul Boesch (kein Mitglied der Gilde), Fritz Brunner oder Hans Schaub mit Wappeneinträgen der neu aufgenommenen Schildner. Mittlerweile ist das Wappenbuch auf beinahe hundert grossformatige prächtige Wappeneinträge angewachsen und wird an dieser Stelle als wichtiges Zeitzeugnis heraldischer Kunst erstmals überhaupt publiziert.(Rolf Kälin)
Auf den Spuren der Landvögte der Herrschaft Maienfeld 1509-1797/99 - Aluis Maissen
Auf der Suche nach heraldischen Spuren der Landvögte der Herrschaft Maienfeld werden wir nur sporadisch fündig, im Gegensatz zu den Untertanenlanden in der „Rezia Minore“. Bekanntlich haben die Drei Bünde während rund 300 Jahren das Veltlin und die Grafschaften Chiavenna und Bormio sowie die Herrschaft Maienfeld verwaltet. Zwischen den Untertanen im Süden und jenen im Norden gab es jedoch zwei bedeutende Unterschiede. Das Veltlin und die beiden Grafschaften verfügten zwar über eine gewisse Autonomie in den einzelnen Gemeinden hinsichtlich der Exekutiv- und Legislativgewalt, sie waren aber nicht Teil des Freistaats Gemeiner Drei Bünde. Bei der Herrschaft Maienfeld lagen die Verhältnisse etwas anders. Diese war einerseits Untertanenland der Drei Bünde und andererseits eine reguläre Gerichtsgemeinde des Zehngerichten-bundes. Ein weiterer Unterschied lag in der Ehrung der Amtsleute am Ende ihrer Amtsperiode. Schon sehr früh entstand im Veltlin und den beiden Grafschaften Chiavenna und Bormio der Brauch, das Innere und Äussere der Amtssitze mit Wappen und Inschriften zu Ehren der Bündner Herren auszustatten. Diese wurden in grosser Zahl als Wappenskulpturen oder Fresken an den Wänden der Amtsräume und an den Fassaden angebracht. In der Bündner Herrschaft gab es diesen Brauch hingegen nicht. Deshalb finden sich heute nur vereinzelte Spuren von ehemaligen Landvögten der Herrschaft Maienfeld. Das Territorium der Bündner Herrschaft umfasste die Stadtgemeinde Maienfeld und die Gemeinden Fläsch, Malans und Jenins. Der Landvogt hatte seinen Sitz auf Schloss Brandis. Der erste Vogt war Johann Carl von Hohenbalken, der letzte Jakob Ulrich Sprecher von Bernegg. Insgesamt waren es an die 145 Landvögte. Die Stadt Maienfeld war das Verwaltungszentrum.(Aluis Maissen)
Wappen mit Bezug zu Legenden und Sagen – Details zur Analyse der schweizerischen Kantons-, Bezirks- und Gemeindewappen - Hans Rüegg
Im Schweizer Archiv für Heraldik, Jahrgang CXXXI - 2017, stellte der Autor seine Analyse der schweizerischen Kantons-, Bezirks- und Gemeindewappen vor. Es ging nicht um die Wappenmotive selbst, sondern um die Motivation für deren Wahl. Diese Beweggründe wurden in 11 Kategorien eingeteilt und einzelne noch weiter untergliedert. Für jede dieser Gruppen wurden zwei bis viert repräsentative Beispiele ausgewählt und vorgestellt. Nun werden in loser Reihenfolge weitere Wappen einzelner Gruppen besprochen. In diesem Heft ist die Gruppe „Legenden und Sagen“ aus der Kategorie „Wappen mit Bezug zu Geschichte und Mythen“ thematisiert. Als Mythologie wird die Gesamtheit der Mythen eines Kulturareales oder eines Volkes, einer Region oder einer sozialen Gruppe sowie ihre systematische Darlegung in literarischer, wissenschaftlicher der religiöser Form bezeichnet.
Die Welt der Legenden und Sagen ist unendlich vielfältig, Kein Wunder, dass ein Teil auch ihren Niederschlag in die Heraldik fand. Es liegt in der Natur, dass sich diese hauptsächlich in ländlichen Gegenden stark verbreiteten, denn der Bezug zur Natur, besonders zur einstmals gefürchteten Bergwelt, beeinflusste direkt das Leben der Menschen, die in diesem Umfeld ihr Einkommen als Bauern und Alphirten fanden. Die Auswertung zeigt, dass aus dem Tessin 6, aus der Innerschweiz, dem Wallis, dem Aargau und aus dem Berner Oberland je 5, aus der Nordwestschweiz, aus dem Waadtland und aus Graubünden je 2 solcher Wappen stammen. Heute wird bei Neuschöpfungen, bedingt durch Fusionen von Gemeinden, höchst selten noch in der Vergangenheit nach Motiven gesucht oder allfällige Vorschläge abgelehnt, was zu bedauern ist.(Hans Rüegg)
Die Welt der Legenden und Sagen ist unendlich vielfältig, Kein Wunder, dass ein Teil auch ihren Niederschlag in die Heraldik fand. Es liegt in der Natur, dass sich diese hauptsächlich in ländlichen Gegenden stark verbreiteten, denn der Bezug zur Natur, besonders zur einstmals gefürchteten Bergwelt, beeinflusste direkt das Leben der Menschen, die in diesem Umfeld ihr Einkommen als Bauern und Alphirten fanden. Die Auswertung zeigt, dass aus dem Tessin 6, aus der Innerschweiz, dem Wallis, dem Aargau und aus dem Berner Oberland je 5, aus der Nordwestschweiz, aus dem Waadtland und aus Graubünden je 2 solcher Wappen stammen. Heute wird bei Neuschöpfungen, bedingt durch Fusionen von Gemeinden, höchst selten noch in der Vergangenheit nach Motiven gesucht oder allfällige Vorschläge abgelehnt, was zu bedauern ist.(Hans Rüegg)
Der Adelsbrief des Alphonse de Sandoz – Ein Beispiel für die Standeserhöhungspraxis im Kanton Neuenburg während der preußischen Herrschaft - Gerhard Seibold
Neuenburg hat als Fürstentum in der republikanischen Schweiz trotz aller Verbindungen, welche es zur Eidgenossenschaft gab, eine eigenständige Entwicklung erlebt. Diese Situation hielt bis zur Mitte des 19. Jahrhundansderts an, als der König von Preußen, welcher in Personalunion auch Fürst von Neuenburg war, auf das Gebiet verzichtete. Jene Verhältnisse werden auch anhand der Adelsverleihungen deutlich, die der in Berlin domizilierende Landesherr ihm genehmen, d. h. seine Herrschaft stützenden Männern, zuteil werden ließ. Zahlreiche Beispiele belegen diese Verhältnisse für die Zeit vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum Ausgang dieser Beziehung. Einer dieser Fälle ist der Neuenburger Bankier und Administrateur des sels (Frederic Henry) Alphonse Franel (1809-1892). Dieser war von seinem Großonkel dem Conseiller d'État Charles Louis de Sandoz adoptiert worden und diesem Umstand wurde auch dahingehend Rechnung getragen, dass König Friedrich Wilhelm III. von Preußen, 1823 dem jungen Franel den Adel als "de Sandoz" verlieh. Die Untersuchung lässt auch deutlich werden, in welch großem Maße eine vor Ort ansässige höhere soziale Schicht, gesellschaftlich und familiär miteinander verbunden war.(Gerhard Seibold)
Was bringt ein Wappenbuch (aus dem Jura)? Einige Gedanken zur Heraldik, der breiten Öffentlichkeit und den Geisteswissenschaften - Nicolas Vernot
Der Autor, seit mehreren Jahren daran tätig, erläutert die Umstände zur Erstellung eines Wappenbuchs der jurassischen Familien, mit dessen Ausarbeitung er von der Société jurassienne d’Émulation unter der Schirmherrschaft des jurassischen Kantonsarchivs betraut wurde. Dieses Projekt umfasst nicht nur den heutigen Kanton Jura, sondern auch die heute zu den Kantonen Basel-Landschaft (Laufen) und Bern (Verwaltungsbezirk des Berner Jura) gehörenden Bezirke, also das gesamte ehemalige Bistum Basel vor 1815. Die Überlegungen des Autors zur Heraldik in der Schweiz, insbesondere zur Heraldik der Familien, die in ihrer Größenordnung mit anderen Ländern nicht vergleichbar ist, bewegen sich nur scheinbar ausserhalb des Rahmens seiner Arbeit, da sie ihm tatsächlich die Möglichkeit geben, dieses Projekt in einem viel breiteren Kontext zu verankern: die Erwartungen der Öffentlichkeit, das Interesse an den Humanwissenschaften, der Charakter der Wappen – dauerhafte, kurzlebige oder mutierende – , ihre Bedeutung und Entwicklung in direktem und engem Zusammenhang mit der sozialen Entwicklung ihrer Träger, die Rolle und Bedeutung der "sprechenden" Wappen.
Die Mitglieder der Schweizerischen Heraldischen Gesellschaft können sich über die für das Frühjahr 2022 angekündigte Veröffentlichung eines Jura-umfassenden Wappenbuchs freuen. Seine Publikation in Papierform wird von der Société jurassienne d’Émulation herausgegeben, während seine Online-Publikation auf der Website des jurassischen Kantonsarchivs zugänglich sein wird. Diese Arbeit wird eine eklatante Lücke füllen, da die anderen Kantone der Westschweiz seit langem ein Wappenbuch für die Heraldik ihres Territoriums besitzen.(Gaëtan Cassina, Übers. Rolf Kälin)
Die Mitglieder der Schweizerischen Heraldischen Gesellschaft können sich über die für das Frühjahr 2022 angekündigte Veröffentlichung eines Jura-umfassenden Wappenbuchs freuen. Seine Publikation in Papierform wird von der Société jurassienne d’Émulation herausgegeben, während seine Online-Publikation auf der Website des jurassischen Kantonsarchivs zugänglich sein wird. Diese Arbeit wird eine eklatante Lücke füllen, da die anderen Kantone der Westschweiz seit langem ein Wappenbuch für die Heraldik ihres Territoriums besitzen.(Gaëtan Cassina, Übers. Rolf Kälin)
Siegel, Fahnen und Wappen der Stadt und Republik Freiburg im Üechtland (1157-1798) - Pierre Zwick
Im Bemühen, die häufige Verwirrung um die einzelnen Machtembleme zu beseitigen, werden die Siegel, Fahnen und Wappen, die die Geschichte Freiburgs von den Anfängen bis zum Ende des Ancien Régime geprägt haben, nacheinander mit ihren jeweiligen Merkmalen vorgestellt. Das älteste bekannte Siegel der Stadt (1225) zeigt über einem Turm und einer zinnenbewehrten Mauer - einer Burg in der Heraldik - einen Schild mit dem Adler der damals ausgestorbenen Zähringer, als Erinnerung an die Gründung Freiburgs durch Berthold IV. Die Fahne, einfach schwarz und weiß, unterscheidet sich deutlich vom Siegel. Erstmals 1410 vertreten, begleitete sie bereits im 14. Jahrhundert die militärischen Formationen Freiburgs. Das Stadtwappen erscheint erst nach 1477 mit dem Status Freiburgs als freie Reichsstadt. Für öffentliche Gebäude wurden Wappenscheiben bestellt. Die beiden schwarzweißen Schilde wurden von einem dritten, gelben Schild mit einem doppelköpfigen Adler, der die Kaiserkrone trägt, überhöht. In der Folge erschienen zwei Löwen als Schildhalter. Bereits 1648 wurde Freiburg mit dem Westfälischen Frieden, der den Dreißigjährigen Krieg beendete, von der kaiserlichen Souveränität befreit. Der Schild mit dem doppelköpfigen Adler verschwand aus dem Stadtwappen und die Kaiserkrone wurde durch eine einfache Laubkrone ersetzt. Die Löwen blieben als Schildhalter bis ins 19. Jahrhundert. Martin Martini schuf in seiner Ansicht von 1606 die interessanteste und komplexeste Komposition des Freiburger Wappens mit Nennung der sigillographischen und heraldischen Geschichte der Stadt, in diesem Fall in einem gevierten Schild. Diese erste Verbindung von Fahne und Siegel in einem einzigen Schild gab Anlass zur Fehlinterpretation, dass die Stadt Freiburg im Mittelalter zwei Arten von Wappen gehabt hätte. Der gevierte Schild, nur mit einer Laubkrone überhöht, wurde als Wappen der Stadt und der Republik Freiburg übernommen. Seine Verwendung endete mit dem Sturz des Ancien Régime. Mit der Trennung von Stadt und Kanton im Jahre 1803 wurde auch dieses Wappen «geteilt». Für den Kanton das «Geteilt von Schwarz und Silber» und für die Stadt das «In Blau ein silberner Zinnenturm mit links angebauter, zinnenbekrönter, in zwei Stufen abfallender silberner Mauer».(Gaëtan Cassina, Übers. Rolf Kälin)
2019
Die Aulendorfer Handschrift des Ulrich Richental zum Konstanzer Konzil und der familiäre Hintergrund ihres Auftraggebers - Horst Boxler
Zum kürzlich gefeierten Jubiläum des Konstanzer Konzil, das von 1414 bis 1418 in der Bischofsstadt stattfand und die durcheinandergeratene römische Christenheit wieder zu einer einigen Kirche führen sollte, sind zahlreiche bemerkenswerte Publikationen erschienen. Eine Wegmarke in der historischen Forschung stellt jedoch das bereits 2010 erschienene Werk des Freiburger Historikers Thomas Martin Buck dar, der nach fast 130 Jahren zum ersten Mal wieder die wohl älteste Abschrift der Konzilschronik des Ulrich Richental in einer kommentierten Ausgabe der Öffentlichkeit und der Forschung vorgelegt hat, nachdem sein Namensvetter Michael Richard Buck 1882 ein Faksimile der Handschrift herausgab. Ihren Namen „Aulendorfer Handschrift“ erhielt die Handschrift vom Ort ihrer Aufbewahrung, welcher der frühe Besitz und die Residenz der Herren, Freiherren und späteren Grafen zu Königsegg-Aulendorf war. Ihr Zusammenhang mit der Entstehung der Handschrift war bisher nur in groben Umrissen bekannt und nur selten erwähnt. So soll dieser Beitrag diesem Mangel abhelfen und auch neue Erkenntnisse über den Verkauf der Handschrift in die USA liefern. So wird die Handschrift heute meist mit dem Zusatz „New Yorker Handschrift“ geführt.(Horst Boxler)
Wappenfresken auf Schloss Salenegg – Die rhätischen Adelsgeschlechter - Aluis Maissen
Für den Bewunderer der Bündner Heraldik bietet die Wappendecke im Gartensaal des Schlosses Salenegg einen besonderen Aspekt. Der Verfasser dieser Arbeit hat in den vergangenen Jahren etliche Wappensammlungen analysiert und beschrieben, so die Bündner Wappen im Veltlin, die Wappenfresken auf der Fürstenburg, die Wappen im Churer Rathaus, die heraldischen Fresken in der St. Rochus Kapelle in Vella sowie die Grabdenkmäler auf den Friedhöfen von Brusio und Castasegna. Es waren wunderschöne Aufgaben und jede dieser Arbeiten hatte ihren besonderen Reiz. Was die Faszination an der Wappendecke auf Schloss Salenegg ausmacht, ist die Tatsache, dass alle 40 Familienwappen und die Embleme der Drei Bünde vom selben Künstler stammen. Dies bewirkt eine Einheit in der Vielfalt. Bereits die Anordnung ist bemerkenswert, die geometrische Struktur mit zehn Wappenreihen in Viererkolonnen. Die Einheit wird zudem von der roten Grundfarbe der Decke und dem rechteckigen Reliefrahmen verstärkt. Auch die Auswahl der Familienwappen ist einheitlich. Es sind nicht alle berühmten Bündner vertreten, sondern nur die adeligen. Man will offenbar unter sich bleiben. Der Auftrag für die Erstellung der Wappendecke kam von Ritter Antonio de Molina, und er ist wohl auch für die Auswahl verantwortlich. Molina stammte aus Buseno im Calancatal. 1616 vermählte er sich mit Violanda von Salis, Tochter des Vespasian von Salis-Maienfeld, Herr zu Aspermont. Dadurch gelangte er in den Besitz des Schlosses Salenegg. Er erweiterte das Gebäude nach Süden und erbaute den Gartensaal im Erdgeschoss. 1640 liess er dort das Deckenfresko ausführen. Das Wappen Molina kommt hier zweimal vor, einmal als Fresko an der Decke und einmal als Wappengravur am offenen Kamin. Ein weiteres Merkmal der Wappendecke ist die Art der Wappen, es sind Familienwappen die nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden können. Zudem gibt es keine Rangordnung zwischen Hoch- und Niederadel. Vertreten ist selbstredend der innere Kreis der Patrizier, die Salis, die Planta und die von Sprecher. Die Reihenfolge ist jedoch zufällig, ebenso die Zugehörigkeit zu den einzelnen Bünden. Mit wenigen Ausnahmen sind die meisten Adeligen der Drei Bünde vertreten, nur wenige fehlen. Beispielsweise die à Marca aus dem Misox, die Latour aus Brigels sowie die von Federspiel zu Lichtenegg. Demgegenüber erscheinen weniger bekannte Geschlechter auf dem Fresko wie die Mennhard, die Giovanelli sowie die Ritter von Sonwickh. Die Aufgabe im Schloss Salenegg bestand also darin, diese wunderschönen Wappen zu beschreiben und sie mit biographischen Texten zu begleiten.(Aluis Maissen)
Wappen mit Bezug zu Spitz- und Übernamen – Details zur Analyse der schweizerischen Kantons-, Bezirks- und Gemeindewappen - Hans Rüegg
Im Schweizer Archiv für Heraldik, Jahrgang CXXXI - 2017, stellte der Autor seine Analyse der schweizerischen Kantons-, Bezirks- und Gemeindewappen vor. Es ging nicht um die Wappenmotive selbst, sondern um die Motivation für deren Wahl. Diese Beweggründe wurden in 11 Kategorien eingeteilt und einzelne noch weiter untergliedert. Nun werden in loser Reihenfolge weitere Wappen einzelner Gruppen besprochen. In diesem Heft ist die Gruppe „Spitz- und Übernamen“ aus der Kategorie „Wappen mit Bezug zur Bevölkerung“ thematisiert. Unter dem Begriff Übernamen wird eine Kennzeichnung verstanden, die einem Menschen oder einer Menschengruppe als Beinamen gegeben wird, weil er oder sie von der Normvorstellung abweichen. So reflektieren Übernamen eine Art von „soziale Kontrolle“, womit oft negative, aber durchaus auch positive Bewertungen stattfinden. Die Übernamen werden von den Sprachwissenschaftlern in Gruppen eingeteilt: nach körperlichen Merkmalen und Körperteilen, nach geistigen Fähigkeiten oder Charaktereigenschaften, nach Tieren oder Pflanzen, nach Gegenständen, nach Berufen, nach religiösen Begriffen, nach Gewohnheiten, nach Abstammung und Verwandtschaft und auf Grund moralischer Urteile. Vorgestellt werden 80 Wappen, 3 aus der deutschsprachigen Schweiz, 26 aus dem Tessin und 61 aus der Romandie. Die Kategorie umfasst nur 1,6 % aller Motive. Weshalb sind im Gegensatz zur deutschsprachigen Schweiz in der Romandie und im Tessin die Wappen mit den symbolisierten Bezügen zu Spitz- und Übernahme übermässig stark vertreten? Da wird doch zum Teil auf kaum schmeichelhafte Eigenschaften wie Geschwätzigkeit (Novaggio) angespielt. Spitz- und Übernamen dürften in beiden Kulturkreisen ähnlich häufig vertreten sein. Hingegen werden die Hoheitszeichen in den beiden Kulturkreisen emotional unterschiedlich wahrgenommen. Im frankophonen Kulturraum wird sowohl den Hoheitszeichen als auch Amtspersonen und staatlichen Institutionen eine andere, intensivere Achtung entgegen gebracht. Das manifestiert sich besonders in der Ehrung der im Dienste des Vaterlandes Gefallenen Soldaten. Somit könnte die sinnbildliche Aufnahme von Spitz- und Übernamen in die Wappen als eine Art von „Adelung“ empfunden werden. Vielleicht führte die Nähe zur Romandie und zu Frankreich bei den beiden Baselbieter Gemeinden Rünenberg und Seltisberg dazu, dass die beiden Übernamen zu Ehrennamen mutierten. (Hans Rüegg)
Von der Monarchie zur Republik – Die Veränderungen in den österreichischen Gemeindewappen - Michael Göbl
Die heutigen Gemeindewappen sind Gemeinschaftssymbole, deren Wurzeln bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Nach und nach erlangten die römisch-deutschen Kaiser bzw. die Landesfürsten das Recht der Wappenverleihungen. Bis 1918 war dieses Recht beim Kaiser von Österreich. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch der Monarchie gelangte nun das Recht der Wappenverleihung in die Kompetenz der neun Bundesländer. 1919 wurde der Adel, seine Titel und Würden aufgehoben, worunter auch die sog. „Bürgerlichen Wappen“ fielen. Dies führte praktisch zu einem Verbot der „Privatheraldik“ und die Gemeindewappen blieben als alleinig angewandte Heraldik übrig, abgesehen vom Staatswappen und den persönlichen Wappen der hohen Geistlichkeit (Bischöfe). Zeitbedingte Diskussionen, wie viele habsburgische, monarchische, religiöse, politische, lokale oder touristische Symbole für die Heraldik erträglich sind und welche darin überhaupt vorkommen dürfen, prägten die Gemeindewappen der 1. und 2. Republik Österreich. (Michael Göbl)
Pankraz Vorster – der letzte Fürstabt von St. Gallen – und seine Lebensjahre im Kloster Muri - Josef Kunz
Pankraz Vorster, 1753 in Neapel als Sohn eines Schweizer Söldner-Offiziers und der Gräfin Anna Maria Berni geboren, starb 1829 im Alter von 76 Jahren im Kloster Muri. Er war der letzte Fürstabt des Klosters St. Gallen. Dieses galt seit seiner Gründung im Jahr 719 über Jahrhunderte als Vorbild klösterlicher Bautätigkeit und war eines der ältesten Klöster in der Schweiz. Mit den napoleonischen Kriegen und dem Untergang der Alten Eidgenossenschaft 1798 ging 1805 in St. Gallen auch eine über tausendjährige Klostergeschichte zu Ende. Historisch entscheidend dabei war die Rolle des letzten Fürstabtes Pankraz Vorster, der mit seiner aristokratisch-feudalistischen Rückorientierung die Existenz des Klosters mit all seinen Rechten und Besitztümern mit Vehemenz verteidigt hatte. 1799 musste er das Stift verlassen und sollte es nie wieder sehen. Trotz seiner vielen Bemühungen an verschiedenen Fürstenhöfen, bei der schweizerischen Tagsatzung, beim Wiener Kongress 1815 oder bei Papst Pius VII. in Rom, war der Untergang des Klosters nicht aufzuhalten. 1819 fand Vorster schliesslich im Kloster Muri seine Exilheimat. Hier lebte er, seinem Schicksal in Demut ergeben, noch 10 Jahre. Hier wurde er 1829 im Oktogon der Klosterkirche begraben. Im Jahre 1923 wurden die sterblichen Überreste von Pankraz Vorster in die Stiftskirche St. Gallen überführt, wo heute noch eine schlichte Gedenktafel an ihn erinnert. In der Klosterkirche Muri erinnert im linken Teil des Oktogons ein Epitaph mit Portrait und Wappen an sein Wirken und seine Lebensjahre in Muri. (Josef Kunz)
Wappengedenken Paracelsus zu Ehren an seiner Geburtsstätte - Rolf Kälin
Wer in Einsiedeln am Klosterplatz zur Dachuntersicht des Rathauses hochblickt, entdeckt unter den Wappen der alteingesessenen Bürgergeschlechter auch eines, welches zum Andenken an einen seiner berühmtesten Mitbürger angebracht wurde. Dieser wurde hier geboren und verbrachte auch die ersten Lebensjahre in unmittelbarer Nähe des Klosterstädtchens: Theophrastus Bombast von Hohenheim, genannt Paracelsus. Zeitgenössische Spuren, die dieser in Einsiedeln selbst hinterlassen hätte, gibt es nicht. Vorhandene Wappen und Denkmäler stammen aus viel späterer Zeit. Der Autor befasst sich in seiner Arbeit unter anderem mit dem Wappen der Hohenheimer, welches sich erstmals auf der Grabplatte für Hans und seinen Sohn Trutwin Bombast von Hohenheim in der Kirche von Riet bei Vaihingen/Enz nachweisen und kurz nach 1456 datieren lässt. Für den illegitimen Nachkommen Paracelsus erscheint dann 1554 ein Wappen in der von Hans Baumann in Salzburg herausgebrachten Schrift "Für Pestilentz". Diese zeigt das Wappen seiner Vorfahren in abgeänderter Form, in dem es den ursprünglichen Hohenheimer Schild mit einem verbreiterten Schildbord ergänzt, der mit acht Kreuzchen belegt ist. Ob Paracelsus zu Lebzeiten allerdings überhaupt ein Wappen geführt hat, vermögen wir nicht zu sagen. Trotzdem entstanden im Raum Einsiedeln zahlreiche Denkmäler, auch heraldischer Art, die das Andenken an den grossen Arzt und Philosophen weiterleben lassen wollen. (Rolf Kälin)
Mit dem Orden des Heiligen Michael ausgezeichnete Schweizer Offiziere im Dienste der Könige von Frankreich 1554-1665 - Michel Popoff
L’ordre de Saint-Michel fut institué en 1469 par le roi de France Louis XI, qui vouait un culte particulier à ce saint, patron du royaume depuis le règne de Philippe VI. Le nombre de chevaliers fut alors fixé à trente-six. Le principal insigne de cet Ordre, au port quotidiennement obligatoire en public, est un collier d’or orné de coquilles reliées les unes aux autres par des nœuds de doubles aiguillettes : à cette chaîne est suspendu un médaillon montrant l’archange Michel debout, terrassant le démon. Porté en leur hôtel, à la guerre, à la chasse ou en voyage, le “petit Ordre” consistait en une représentation de saint Michel attachée à une chaîne d’or ou à un cordonnet obligatoirement de soie noire dès Henri II ou Charles IX. Très rapidement, cet ordre fut très généreusement distribué et le chiffre de trente-six largement dépassé pour atteindre plusieurs centaines. Cette situation amena Louis XIV à réformer l’Ordre de Saint-Michel en 1665, fixant entre autres à cent le nombre de ses chevaliers. À la fin du XVIIIe siècle fut entrepris le Recueil historique des chevaliers de l’Ordre de Saint-Michel, onze volumes conservés à la Bibliothèque nationale de France (cote Fr. 32864-32874). Cette somme, qui ne put être imprimée à cause de la Révolution, est actuellement en voie de publication intégrale par les soins de l’auteur du présent article. Des 4902 entrées, il a extrait les 21 notices de militaires suisses décorés de l’Ordre de Saint-Michel au service des rois de France. En l’absence de statistiques définitives, la Suisse est probablement le pays étranger qui a donné le plus grand nombre de récipiendaires de cet Ordre. (Gaëtan Cassina, Übers. Rolf Kälin)
Die Entwicklung der Wappenskulpturen des Pierre d'Aubusson, Grossmeister des Hospitalordens vom Heiligen Johannes von Jerusalem - Jean-Bernard de Vaivre
Während den ersten Jahren der Magistratur von Pierre d'Aubusson (1476) wurden bei den Wappendarstellungen zunächst wie in der Zeit seiner Vorgänger zwei Schilde nebeneinander gesetzt. Der eine zeigte jeweils das Ordenswappen, der andere das Familienwappen des Großmeisters. Dann den gevierten Schild, ein Brauch, der sich seit dem 14. Jahrhundert etabliert hatte. So hat man sich im Laufe der Jahre an einer einfachen und zugleich klassischen Typologie orientiert. Am Tag nach der Ernennung von Pierre d'Aubusson zum Kardinal von Saint-Adrien (1489) wurden nicht nur die Insignien dieser Würde in alle skulpturalen Darstellungen übernommen, die in die vom Großmeister bestellten Gebäude eingefügt werden mussten, nein, es besteht kein Zweifel, dass der Großmeister selbst einen sehr präzisen Entwurf erstellt hatte, der allen für die Baustellen verantwortlichen Kommandeuren aufgezwungen wurde, nicht nur auf der Insel Rhodos selbst, sondern in allen Besitztümern des Ordens, sowohl im Dodekanes als auch auf dem Brückenkopf der anatolischen Küste, dem Château Saint-Pierre. (Jean-Bernard de Vaivre, Übers. Rolf Kälin)
Ancora sull’araldica della Dominazione Francese nel ducato di Milano - Gianfranco Rocculi
La ricerca di ulteriori reperti araldici inerenti il corpus della Dominazione Francese del Ducato di Milano, ci ha condotto oltre la zona geografica chiamata comunemente Lombardia, spingendoci fino a Carpi. Luogo prestigioso e Stato autonomo situato nell’Emilia, ha pagato un prezzo molto alto per la sua dedizione alla causa francese, perdendo la propria autonomia che sotto la dinastia dei Pio durava da secoli. L’analisi a vasto raggio dell’influenza di Milano nel Nord Italia, porta alla conoscenza di diversi reperti araldici, fonti preziose per ulteriori indagini e ritrovamenti. Questo terzo ampliamento araldico non concluderebbe, quindi, la ricerca giustamente destinata a protrarsi nel tempo. La scoperta e l’approfondimento del modello di ramificazione capillare delle influenze autocelebrative francesi sono di grande aiuto per leggere e rileggere alcuni importanti episodi del relativo periodo storico. (Gianfranco Rocculi)
2018
Ein Schatz vom Bodensee: Die Chronik des Ulrich Richental über das Konzil zu Konstanz (1414-1418) und ihre Überlieferung - Ludwig Biewer
Das Konzil zu Konstanz (1414-1418) war das einzige, das auf deutschem Boden stattgefunden hat. Es war ein „Welterereignis des Mittelalters“, nicht zuletzt, weil mit ihm das große abendländische Schisma von 1378 bis 1417 glücklich überwunden wurde, während dem seit 1409, dem Konzil zu Pisa, drei konkurrierende Päpste und ihre Obödienzen mit- oder besser: gegeneinander gerungen hatten. Vom Verlauf des Konzils, der wesentlich von dem römisch-deutschen König Sigismund aus dem Hause Luxemburg (1410-1437. Kaiser seit 1433) mitbestimmt wurde, künden viele offizielle Quellen, die ediert sind und auf denen gute Darstellungen beruhen. Zum „gesellschaftlichen Teil“ der Kirchenversammlung, vom Klatsch und Tratsch des Weltereignisses und über das Alltagsleben in der Stadt (Bischofsitz seit vor, Reichstadt seit 1237, z. Z. des Konzils etwa 6000 bis 8000 Einwohner) während der vierjährigen Ausnahmezustandes – es mussten in vier Jahren mehr als 70 000 Fremde bewirtet werden – aber gibt es nur die Darstellung des Konstanzer Bürgers Ulrich Richental (um 1365-1437). Das Werk dieses wohlhabenden und gebildeten niederen Klerikers, das kurz nach 1420 entstand und wohl vom Rat der Stadt in Auftrag gegeben wurde, ist nicht im Original überliefert, sondern nur in nach 1460 entstandenen Abschriften, von den 16 erhalten und von denen wiederum sieben z. T. reich illustriert sind. Das gilt auch für die sog. Konstanzer Handschrift (um1464/65), die im städtischen Rosgartenmuseum bewundert werden kann und durch eine gute Faksimileausgabe leicht zugänglich ist. Diese Handschrift enthält etwas mehr als 800 Wappendarstellungen, bei denen die stark stilisierten, von Prälatenhüten oder Mitren überhöhten Wappen von Geistlichen, nämlich der Konzilteilnehmer, überwiegen. Es sind aber auch Wappen weltlicher Herren und von Konstanzer Bürgern zu sehen. Die Konstanzer Handschrift der Richental-Chronik ist also nicht nur eine Quelle zum Ablauf des Konstanzer Konzils und des Lebens in der gastgebenden Stadt, sondern kann auch als ein wichtiges und schönes Wappenbuch angesehen werden.(Ludwig Biewer)
Die Grafen zu Neipperg als Schweizer Bürger, Johann Stumpfs Irrtum und die Fürsten von Montenuovo - Horst Boxler
Vom letzten Viertel des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts folgen wir dem Schicksal der Erzherzogin Marie Louise von Österreich, die aus Staatsraison dem neuen Herrscher über Europa, Napoleon I., geopfert wurde, und dem Generalfeldmarschall Graf Adam Adalbert von Neipperg, Held der Befreiungskriege in der Schweiz und Italien. 1814 gingen die beiden eine Verbindung ein, die bis zu Neippergs Tod hielt, der der nachmaligen Herzogin von Parma die Staatsgeschäfte führte. Aufgrund einer irrtümlichen Nachricht in Johann Stumpfs Schweizerchronik wurden Neipperg und all seine Nachkommen aus dessen erster Ehe bis heute in Sargans eingebürgert. Seine Kinder, die er vor und während seiner morganatischen Ehe mit Marie Louise gezeugt hatte, wurden zu Grafen und Fürsten von Montenuovo erhoben, was ihr prächtiges Wappen dokumentiert. Mitte des 20. Jahrhunderts starben sie allerdings im Mannesstamm aus. Als Marie Louise 1847 starb, hatte auch sie die Herzen ihrer parmenischen Untertanen gewonnen, die ihr den Beinamen „la buona duchessa“ verliehen.(Horst Boxler)
Die Eguilly und die Saffres - Jean-Bernard de Vaivre
Zwei nur noch fragmentarisch erhaltene heraldische Reliefs des burgundischen Schlosses von Eguilly werden durch Notizen und Skizzen von Pierre Palliot, Drucker und Buchhändler in Dijon und Autor von La vraye et parfaite science des armoiries aus dem Jahr 1660, ergänzt. So werden auch die beiden Wappenreliefs des Schlosses wiedergegeben: das Wappen der ersten Herren von Eguilly und das der Poinsot, die sich nach den ersteren Poinsot von Eguilly nannten. Palliot hebt diese Wappen, sowie auch dasjenige der Choiseul, den Nachfolgern der Poinsot, mit einem Hinweis auf die Buntglasfenster der Schlosskapelle hervor. Der vorliegende Aufsatz konzentriert sich in erster Linie auf die Untersuchung der Wappen der Eguilly, ihrer Grabplatten und Siegel. Von Dreue d'Eguilly († 1343) bis Thomas (1402) tragen alle in ihren Wappen einen Turnierkragen im Schildhaupt, der ihre Zugehörigkeit zu einem jüngeren Zweig der Saffres, einem bedeutenden Haus im Burgund, das seit dem zwölften Jahrhundert bekannt ist, zeigt. Der erste, der das Land von Eguilly erhielt und den Namen und das mit einem dreilätzigen Turnierkargen brisierte Wappen der Saffres trug, war Hervé der III., der jüngere Bruder von Guy dem I. de Saffres († 1279). Der zweite Teil beschäftigt sich mit den Saffres, ihren Wappen und Allianzen. Sie führten in Rot fünf schragenförmig gesetzte auffliegende silberne Seeadler (2:1:2). Dieses Wappen erscheint seit dem Siegel von Hervé dem II. (1247) bis hin zu Johannes, der als letzter männlicher Nachkomme der Linie nach 1385 starb. Auch die Grabsteine tragen ihre Wappen, von Guy dem I. von Saffres († 1279) bis Guy dem II. († 1305), seinem Enkel, über Hervé den IV. († 1306), seinem Sohn und seiner Frau Béatrice de La Bussière († 1318). Der Autor setzt sich abschliessend zugunsten einer Untersuchung der wappenführenden Familien der burgundischen Häuser ein, die ihre Schilde mit Seeadlern belegten, ohne notwendigerweise an einen gemeinsamen Vorfahren gebunden zu sein. (Gaëtan Cassina, Übers. Rolf Kälin)
Die von einem Ritter des Johanniterordens gestiftete Sankt Lukas Kapelle in Soroni (Rhodos) - Jean-Bernard de Vaivre
Diese kleine Kapelle gehörte in Bezug auf ihre Gründung zu den wenigen Fällen, die auf der Insel Rhodos noch aufgeklärt werden mussten. Bevor die Stadtverwaltung von Soroni die Reinigung des Marmorreliefs über der Tür angeordnet hatte, konnten unter den mehrfachen Gipsschichten nicht mehr als die Konturen von drei Wappenschilden erkannt werden. Der Marmor enthüllt heute wieder sowohl den Inhalt der Wappenschilde als auch eine datierte epigraphische Inschrift: Einen Schild mit dem Ordenskreuz neben einem Schild mit drei halben gestürzten Spitzen, also dem Wappen des Grossmeisters Jacques de Milly (1454-1461); das dritte Wappen in Rautenform ist geteilt und zeigt oben einen aus der Schildteilung wachsenden Löwen und unten ein Feld aus Kornähren oder Schilf; die eingravierten Ziffern benennen das Erbauungsdatum 1460 und die Inschrift enthüllt schliesslich den Namen des Stifters und Erbauers, Bruder Johannes von Agnon. Wenn auch die Form seines Schildes von mehreren anderen Rittern an verschiedenen Orten verwendet wurde, erscheint doch das Schildbild im unteren Teil des geteilten Wappens in der mittelalterlichen Heraldik vollkommen aussergewöhnlich. Dieser spanische Ritter, dessen Funktion diejenige des Guardamangier, des für die Mundversorgung des Palastes zuständigen Beamten war, erscheint 1453 und 1462 in den Registern der Magistralkanzlei des Ordens. Johannes von Agnon aus der Burggrafschaft Amposta war trotz seines relativ bescheidenen Ranges ein enger Verwandter des Großmeisters und Inhaber eines Palastbüros. Der Autor schliesst seine Ausführungen mit der Feststellung, dass dieses Wappenrelief eine wichtige Ergänzung zu den bisher bekannten Wappen der Ritter von Rhodos bedeutet.(Gaëtan Cassina, Übers. Rolf Kälin)
Marguerite-Jeanne und Charlotte von Pestalozzi, gräfliche Stiftsdamen des Adelskapitels von Salles-en-Beaujolais - Michel Francou
Das Adelskapitel von Salles folgte im 18. Jahrhundert einer kleinen benediktinischen Gemeinschaft, die im 14. Jahrhundert ein kluniazensisches Priorat abgelöst hatte. Einer der Gründe für den Wohlstand dieses Klosters, das junge Mädchen aus den großen Familien aller Provinzen Frankreichs anzog, war die relative Freiheit, die ihnen blieb. Sie lebten getrennt und nicht in Gemeinschaft und trafen sich nur zu Gottesdiensten. Jede Stiftsdame besaß eines der Häuser, die den Haupthof des Klosters umgaben. Marguerite-Jeanne und Charlotte waren zwei Schwestern des Pestalozzi-Zweiges von Chiavenna (Stadt und Tal im Nordosten der Lombardei, damals unter der Herrschaft Graubündens), der seit Anfang des 17. Jahrhunderts in Lyon ansässig war und den Ursprung einer Ärztedynastie des Collège de Médecine de Lyon bildete, welche sich über das ganze 18. Jahrhundert etablierte. Die beiden Schwestern traten in das Kapitel von Salles ein und wurden 1773 gräfliche Stiftsdamen. Auf der heraldischen Ebene soll zunächst daran erinnert werden, dass das Wappen des Kapitels von Salles das der Beaujeu war: In Gold ein steigender rot bewehrter und rot bezungter schwarzer Löwe, im Schildhaupt überdeckt von einem fünflätzigen roten Turnierkragen; Der Schild ist mit dem achtspitzigen Malteserkreuz hinterlegt, welches zwischen den Kreuzarmen mit vier Lilien ergänzt ist, das Ganze überhöht von einer Grafenkrone. Was die Pestalozzi von Lyon betrifft, so scheint sich ihr Wappen zwischen dem 16. und der Mitte des 18. Jahrhunderts verändert zu haben, es sei denn, es handelt sich um Fantasien der verschiedenen Autoren, die die Wappen gezeichnet und veröffentlicht oder einfach nur beschrieben haben. Sie waren ursprünglich identisch mit dem Wappen des Chiavenna-Zweiges, der sich neben Lyon vor allem nach Zürich, wo sie heute noch gedeihen, aber auch nach Amsterdam, Wien und Graubünden verzweigte. (Gaëtan Cassina, Übers. Rolf Kälin)
Die schweizerische Ordensgemeinschaft der Ritter vom Hl. Grab zu Jerusalem und der verlorene Wappenfries von Beromünster - Rolf Kälin
Das Chorherrenstift Beromünster besitzt eine seit alters her blühende Wappentradition. Schon der Minnesänger und Heiliggrabritter Hesso von R[e]inach (1234 - ca. 1276), Chorherr des Stiftes, fand hier seine letzte Ruhestätte. 1950 wurde diese alte Wappentradition mit der Errichtung der Schweizerischen Statthalterei des Ritterordens vom Hl. Grab zu Jerusalem wieder aufgenommen und 1952 liess der Orden im Kreuzgang einen prachtvollen Wappenfries anlegen. Im Zuge der Gesamtrenovation des Kreuzgangs 1985 wurde der Wappenfries jedoch aus umstrittenen Gründen übertüncht und es mussten als Ersatz etwas abseits neue Wappentafeln mit den Wappen der Damen und Ritter des Ordens angebracht werden. (Rolf Kälin)
Das neue Gotthardwappen für die Schweizerischen Bundesbahnen - Rolf Kälin
Die neuen Gotthardzüge „Giruno“, die durch den Gotthardbasistunnel fahren werden, tragen künftig, wie schon Vorgängerlokomotiven aus den 1950er Jahren, wieder die Namen der 26 Schweizer Kantone. Ihre nach den historischen Vorbildern reproduzierten Wappen werden in den Speisewagen der neuen Züge zu bewundern sein. Zusätzlich werden drei Züge dem Gotthard, dem Ceneri und dem Simplon gewidmet. Bei der Erstellung der neuen Wappen von Simplon und Ceneri bot sich die Verwendung der entsprechenden Gemeindewappen an. In der Schweiz gibt es aber keine Gemeinde und auch keine eigentliche Ortschaft, welche mit Gotthard benannt wurde. Das Gotthard-Wappen musste also komplett neu entworfen und umgesetzt werden. Der Autor erstellte dazu die Entwürfe. Die Ausführung des 3-D Models und des Aluminiumgusses besorgte Rolf Schuler, Bemalung und Lackierung des Wappenschildes wurden durch Antoinette Liebich ausgeführt. Das neue Wappen ist gespalten und zeigt vorne die beiden die Reuss überspannenden Brücken in der Schöllenen und hinten den heiligen Gotthard als Namensgeber für Gotthardpass und Gotthardmassiv. Es ist zu hoffen, dass die Schweizerischen Bundesbahnen damit künftig nicht nur Nostalgikern, sondern allen Reisenden von nah und fern Freude bereiten können.(Rolf Kälin)
Wappen und Siegel der Dynastie von Schauenstein-Ehrenfels – Herren zu Hohentrins, Tamins und Reichenau - Aluis Maissen
Bei dieser Arbeit ging es nicht primär um die Erforschung der Familiengeschichte von Schauenstein, sondern um die professionelle Darstellung der Heraldik der Linie von Schauenstein-Ehrenfels. Dabei wurden Mauerfresken, Steinskulpturen und Siegel von drei Vertretern aus der Linie Reichenau beschrieben, nämlich Rudolf, Johann Rudolf und Franz Thomas von Schauenstein. Aus der Linie Cazis wurden eine kolorierte Zeichnung und ein Siegelstempel (Petschaft) aus Messing des Thomas von Schauenstein analysiert. Mit besonderer Sorgfalt wurde zudem ein bisher unbekanntes Textilwappen in der Sammlung der katholischen Pfarrei von Domat/Ems untersucht. Durch Vergleiche mit einem Gipssiegel im Staatsarchiv Graubünden konnte es mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Landrichter Franz Thomas von Schauenstein zugeordnet werden. (Aluis Maissen)
Wappen mit Bezug zu historischen Ereignissen und Begebenheiten - Details zur Analyse der schweizerischen Kantons-, Bezirks- und Gemeindewappen - Hans Rüegg
Im Schweizer Archiv für Heraldik, Jahrgang CXXXI–2017, stellte der Autor seine Analyse der schweizerischen Kantons-, Bezirks- und Gemeindewappen vor. Es ging nicht um die Wappenmotive selbst, sondern um die Motivation für deren Wahl. Diese Beweggründe wurden in 11 Kategorien eingeteilt und einzelne noch weiter untergliedert. Nun werden in loser Reihenfolge die Wappen einzelner Gruppen vorgestellt. In diesem Heft ist die Gruppe „Historische Ereignisse und Begebenheiten“ aus der Kategorie „Wappen mit Bezug zu Geschichte und Mythologie“ thematisiert. Bei den Ereignissen handelt es sich um einmalige Geschehnisse, meistens von überregionaler Bedeutung. Unter dem Begriff „Begebenheiten“ sind örtlich oder zeitlich begrenzte Vorkommnisse zusammengefasst, die aufgrund besonderer Umstände auftraten oder auftreten konnten. Vorgestellt werden 64 Wappen. Die Gruppe selbst umfasst mit 116 Wappen nur 2,2 % aller Motive. Zuerst stehen Motive aus der Prähistorie: Ausgrabungen und Fundstücke. Anschliessend folgen einige Motive mit Bezügen zur Römerzeit. Weitere stehen in Bezug zum mittelalterlichen Hochadel und Klerus. Wappenmotive mit Bezügen zur militärischen Organisation und kriegerischen Auseinandersetzungen sind recht zahlreich festzustellen. Weitere erinnern an Bündnisse oder verweisen auf einstige Strukturen des Rechts- und Gesellschaftswesens. Letztendlich befasst sich der Aufsatz mit mehreren Wappenmotiven, die an einzelne Begebenheiten erinnern und sich nur schwerlich systematisch gruppieren lassen. (Hans Rüegg)
Stemmi 'parlanti' nell'araldica civica medievale – una sintesi statistica - Alessandro Savorelli
Un'analisi statistica condotta su circa 2000 stemmi civici medievali mostra che l'araldica comunale non ha contribuito in misura sostanziale – come ripete spesso – a una deriva banalizzante dovuta alla massiccia presenza degli stemmi parlanti. L'analisi dei dati mostra che la percentuale degli stemmi parlanti oscilla tra il 20 e il 26% del totale (con qualche oscillazione locale), dunque molto simile a quella stimata da M. Pastoureau per l'araldica in generale: la percentuale aumenta nelle città minori e nei centri rurali e riguarda semmai in qualche misura una fase cronologicamente più avanzata dell'araldica comunale, come riflesso della diversa gerarchia urbana. Le città più importanti, come mostra il confronto statistico tra le diverse tipologie iconografiche dei loro stemmi (parlanti, astratti, allusivi) non privilegiano in alcun modo l'elemento parlante poiché hanno di fronte una più ampia gamma di scelte simboliche, che riflettono la diversa percezione del loro rango e della loro autonomia rispetto ai centri minori. La tecnica specifica della costruzione degli stemmi parlanti nell'araldica delle città non differisce nella sostanza da quella dell'araldica delle famiglie, sia quando esprime una relazione diretta col toponimo o si fondi su assonanze (di rado in relazione con l'etimologia autentica), allusioni più o meno mediate o rebus. Si può concludere che il tipo parlante negli stemmi civici medievali non è dominante in assoluto sotto il profilo quantitativo, né possiede alcun primato rispetto alle altre tipologie figurative: e che perciò le città medievali, attraverso l'uso degli stemmi parlanti, non hanno contribuito in misura decisiva a una decadenza formale del fenomeno araldico. L’araldica parlante delle città medievali, dunque, non dequalifica l’araldica, ma interpreta, spesso con efficacia e correttezza formale, uno dei suoi tradizionali modus operandi semantici.(Alessandro Savorelli)
L’Araldica della Dominazione Spagnola nel Ducato di Milano - Gianfranco Rocculi
Nel panorama crescente degli attuali studi e scritti riguardanti la storiografia relativa sia al breve periodo Imperiale, sia all’intera epoca della Dominazione Spagnola del ducato di Milano (1535-1706) che ne è stato il lungo epilogo, il settore riguardante l’araldica risulta tuttora insufficientemente analizzato. Un patrimonio importante che, pur non sopravvissuto nella sua interezza a causa delle devastanti conseguenze del trascorrere del tempo, delle distruzioni operate da guerre e dall’uomo, dall’oblio e dalla damnatio memoriae, contribuì alla creazione della storia dei luoghi ed alla valorizzazione dei loro siti d’arte. Si tratta spesso di reperti, che conservati in luoghi poco accessibili e quindi ben custoditi, sono stati collazionati allo scopo di comporre un corpus che consenta di ripercorrere gli intensi e multiformi momenti salienti della preziosa storia del pensiero simbolico encomiastico della “comunicazione non verbale”, con particolare riferimento alle strategie politico comunicative di uomini che hanno vissuto quel mondo, contribuendone alla realizzazione.(Gianfranco Rocculi)
2017
Die Vögte des Augustiner-Chorherren-Stiftes Embrach und ihre Verstädterung in Winterthur und Klein-Basel (Teil 2) - Horst Boxler
Nach Teil 1, der die Geschichte der Vögte des Augustiner-Chorherrenstifts in Embrach/ZH und ihre Verästelung in der ministerialen Adelsgruppe, wie sie im Gefolge der Stauferherrschaft im 11. bis 13. Jahrhundert entstand, aufzeigte, folgt im zweiten Teil ihr scheinbarer Niedergang als landsässige Dienstadelsfamilie. Richtig ist zwar, dass die wirtschaftlichen Ressourcen zur Versorgung mehrerer Nachkommen der dritten Generation am Ort nicht mehr gegeben waren, doch boten die aufstrebenden Städte für umsichtig handelnde Familien und Einzelpersonen durchaus einen starken gesellschaftlichen Anreiz. So auch bei der Vogtsfamilie von Embrach, die zu Bürgern von Winterthur und Klein-Basel wurden und trotz ihrer verschiedenen Wirkungsorte das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit bewahren konnten. Vom Klein-Baseler Zweig sind mannigfache Aktivitäten und die Zugehörigkeit zum Rat überliefert, an einigen Urkunden auch das persönliche Siegel der Familienoberhäupter, die sich nun von Embrach nannten. Und fast wie in der alten Heimat um Embrach fanden sich auch hier Vernetzungen der ministerialen Familien, deren Beziehungen, dargestellt in ihren Wappen, eine Art heraldisches Soziogramm der Familien schufen, die schichtspezifisch miteinander in engem Kontakt standen; man könnte dafür auch den Neologismus „Heraldogramm“ einführen. Auch wenn die Nachkommen der Vögte in diesen beiden Städten ausstarben, verblieb ein wohl recht früh abgespaltener Zweig in Laufenburg und stellte bereits bei ihrem urkundlichen Auftreten zwei Bürgermeister der damals noch habsburgischen Stadt. Die Laufenburger überlebten hingegen bis heute und finden sich in einer elsässischen Winzerfamilie wieder. (Horst Boxler)
Heraldik und Chorgestühlkunst aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Genf - Meister Roliquin von Dordrecht - Corinne Charles
Das Genfer Museum für Kunst und Geschichte beherbergt in seinen Sammlungen ein Fragment aus einem der zahlreichen Ensembles von Chorgestühlen, welche während des 15. Jahrhunderts in Genf gefertigt wurden. Dieses Fragment aus Nussbaumholz mit einem geschnitzten Schild, welcher die beiden Initialen F und V zeigt, ist in der Kartei des Museums für Kunst und Geschichte aktuell gegen 1500 datiert und im Haus Tavel in Genf ausgestellt. Eine Annäherung dieses Werks an ein anderes Fragment eines Chorgestühls, welches einen Hutte tragenden Bauern zeigt, bot sich an. Da aber keine Informationen über Entstehung und Herkunft dieser Einzelfragmente vorhanden sind, war es schwer, ja sogar unmöglich, die Initialen auf dem geschnitzen Schild einer Person zuzuweisen. Es brauchte ein Zusammenwirken verschiedener Faktoren, um das Rätsel zu lüften, eine vertiefte Studie über die während des 15. Jahrhunderts für die diversen Kirchen Genfs realisierten Chorgestühle, welche im Folgenden versetzt oder beschädigt wurden, während der Reformation verschwanden oder in den folgenden Jahrhunderten teilweise zerstört wurden. Die übrig gebliebenen Elemente wurden schliesslich wieder hervorgeholt, um ein zusammenhängendes Ensemble zu gestalten, wie wir es heute in der Kathedrale Saint-Pierre in Genf sehen können. Diese grosse Restaurierung wurde von Jean-Daniel Blavignac (1817-1876) in der Mitte des 19. Jahrhunderts durchgeführt. Verträge oder eventuelle Rechnungsbelege waren verschwunden. Die Archivstudie schien also in eine Sackgasse zu führen. Ein Umweg über zwei Dokumente erlaubte es jedoch, die Wichtigkeit eines Kistler-Zimmermanns, der bis dahin vor allem für einige vereinzelte Arbeiten im Auftrag des Herzogtums Burgund auf der Baustelle der Kartause Champmol-les-Dijon bekannt war, besser einzukreisen. Diese Studie ist damit die erste Monographie die versucht, das Wirken Roliquins von Dordrecht als Meister des Genfer Chorgestühls und Schöpfer des Schildes mit den beiden Initialen F und V zu schildern.(Corinne Charles, Übers. Rolf Kälin)
La famiglia Lingua - Un percorso araldico - Giancarlo Comino
Il percorso che viene qui proposto segue l’evoluzione dei segni identitari e araldici di una famiglia dopo la formazione del suo patronimico alla metà del XII s. sino ai nostri giorni attraverso le numerose mutazioni che uno stemma poteva subire prima dell’epoca del « congelamento » delle registrazioni, per il contesto politico, il trasferimento geografico, le mode, o, più semplicemente, per avvenimenti fortuiti ed occasionali. L’Autore ci fa seguire in otto secoli la famiglia Lingua e la storia del suo stemma, che per la sua struttura, un bandato sormontato da un aminale in capo, è stato particolarmente soggetto a cambiamenti ; questi attraverso la feudalità lombarda, la nobiltà consolare delle città mediovali piemontesi, il patriziato urbano, la nobiltà dello Stato principesco in Savoia e in Francia. L’articolo riporta anche la recente scoperta di uno schizzo miracolosamente conservato negli archivi milanesi disegnato dal primo titolare del cognome e raffigurante una testa d’uomo a lingua in fuori, simbolo destinato in seguito a passare al cimiero della famiglia Lingua.(Giancarlo Comino, trad. Marco Foppoli)
Ein kaum beachtetes Murenser Epitaph für zwei ausserhalb des Klosters verstorbene Aebte - Rolf Kälin
Etwas unscheinbar zwischen all der Rokokopracht in der Kirche des ehemaligen Klosters Muri ist an einem Hauptpfeiler im Oktogon etwas erhöht ein mit Wappen bestücktes Epitaph angebracht, welches kaum einmal zur Kenntnis genommen wird. Dieses Epitaph zeigt Widmung, Portraits und Wappen zweier Murenser Aebte, die in ihrer Vita weit auseinanderliegen. Es ehrt die Verdienste von Fürstabt Plazidus Zurlauben (13. März 1646 - 14. September 1723) als grossen Vermehrer des klösterlichen Besitzes und Abt Ambrosius Bloch (11. Dezember 1768 – 5. November 1838) als dessen Beschützer und Verteidiger. Das Epitaph dürfte nach dem Ableben des Zweitgenannten entstanden sein und ist wohl einheimischer Provenienz. Entsprechend der Epoche treten die hier besprochenen heraldischen Zeichen der beiden Würdenträger sehr zurückhaltend in Erscheinung und vermögen in ihrer Ausführung nicht über den heraldischen Zerfall der entsprechenden Zeit hinwegzutäuschen. Dennoch ist das Epitaph insgesamt sicher als etwas Aussergewöhnliches zu betrachten, da es dem Umstand Folge leistet, zwei Aebte in einer Inschrift zu vereinen, welche als Gemeinsamkeit lediglich aufweisen, als Einzige bis zur Aufhebung des Klosters dem Tod ausserhalb von dessen Mauern anheim gefallen zu sein und auch nicht in selbigem ihre letzte Ruhestätte gefunden zu haben. (Rolf Kälin)
Heraldik auf dem Friedhof - Protestantische Grenzfriedhöfe in Brusio und Castasegna - Aluis Maissen
Als Grenzfriedhöfe verstehen wir jene zwei Friedhöfe im Süden Grabündens, auf denen reformierte Amtsleute oder deren Angehörige bestattet wurden, die in den ehemaligen Untertanenlanden Veltlin, Chiavenna und Bormio während der regulären Amtszeit verstorben waren: Brusio und Castasegna. Als Folge der im Mailänderkapitulat von 1639 enthaltenen Religionsbeschränkungen, wurden diese ausserhalb der Untertanenlande beigesetzt. Durch den Veltliner Aufstand vom Juli 1620 und die Vertreibung der Bündner verloren die Drei Bünde die Untertanenlande Veltlin und die Grafschaften Chiavenna und Bormio. Dieser Zustand dauerte bis 1639, d. h. bis zum Abschluss des 1. Mailänder Kapitulats. Durch die Vertragswerke vom 3. September 1639, abgeschlossen zwischen den Drei Bünden und Mailand-Spanien, erhielten die Bündner die Herrschaft über die Untertanenlande wieder zurück. Die Souveränität Bündens über die Untertanenlande wurde zwar garantiert, aber empfindlich eingeschränkt, insbesondere durch konfessionelle Bestimmungen. Protestanten waren Wohn- und Haushaltungsrecht verwehrt. Von diesem Verbot ausgenommen waren nur die Amtsleute sowie protestantische Grundbesitzer. Diese durften sich während dreier Monate auf ihrem Gut aufhalten, Die anwesenden Protestanten durften ihren Glauben jedoch nicht ausüben. Es war ihnen nicht einmal erlaubt, ihre Kinder nach evangelischem Ritus zu taufen. Sie mussten dies ausserhalb der Untertanenlande tun. Im reformierten Friedhof von Brusio haben sich 16 historische Grabdenkmäler erhalten, in Castasegna 7, also insgesamt 23 Gedenktafeln. Diese wurden vom Verfasser in einer speziellen Studie unter dem Titel „Protestantische Grenzfriedhöfe in den Drei Bünden. Brusio und Castasegna“ im Jahr 2012 veröffentlicht. Von der Struktur her zeigen 11 Grabmäler die klassische Form mit dem Familienwappen des Verstorbenen und der darunter stehenden Grabinschrift, die übrigen weisen lediglich Grabinschriften auf. Aus heraldischen Interessen werden die Ersteren deshalb an dieser Stelle publiziert. Es verbleibt noch ein kurzer Hinweis auf die Inschriften. Diese sind nach Humanistenart in Latein verfasst. Anhand von Fotoaufnahmen wurden sie genau entziffert und transkribiert. Es wurde jedoch darauf verzichtet, diese wörtlich zu übersetzen. Im Allgemeinen enthalten sie einen historischen Teil, der wichtige Daten über persönliche Würden und politische Ämter sowie Familienverhältnisse, Geburts- und Todesdaten enthalten. Darüber hinaus sind sie oft mit poetischen Beigaben bereichert, die praktisch nichts zur Geschichte beisteuern. Deshalb wurden die wichtigsten Fakten der Inschriften jeweils in einer Zusammenfassung wiedergegeben.(Aluis Maissen)
Klassifizierung der Beweggründe für die Wahl von Wappenmotiven - Eine Analyse der schweizerischen Kantons-, Bezirks- und Gemeindewappen - Hans Rüegg
Das Wappenbuch der Zürcher Gemeinden enthält als einziges ein Register der Wappenmotive. Angeregt durch diese Auflistung erstellte der Autor ein Register über die Motive aller öffentlichen Wappen der Schweiz. Die Motive sind gruppiert in Heroldsbilder, Tiere, Pflanzen, Werkzeuge, Gegenstände des täglichen Gebrauchs, Waffen, Bauwerke, Wasser, Berge, Menschen, Symbole für abstrakte Begriffe, Schriftzeichen. Wappen mit mehreren Motiven sind entsprechend mehrfach enthalten. Diese Aufstellung ist interessant und aufschlussreich, befriedigt aber nicht alle Bedürfnisse. Rückschlüsse über die Beweggründe zur Annahme der Wappenmotive können aus dieser Gruppierung nur beschränkt abgeleitet werden. Deshalb wurden für die vorliegende Arbeit Kategorien der Beweggründe (Motivationen) definiert und die Wappen entsprechend zugewiesen. Als Basis dienten die kantonalen Wappenbücher, verschiedene Abhandlungen im Schweizer Archiv für Heraldik, und in etlichen Fällen auch die Internetauftritte von Gemeinden. Die vorliegende Arbeit basiert auf 3441 erfassten Wappen: 2249 aktive und 1131 ehemalige bzw. fusionierte Gemeinden, sowie 61 Kantons- und Bezirkswappen. Nicht berücksichtig sind die Wappen früherer Zivilgemeinden, die heute oft als Dorfwappen weiterhin im Gebrauch sind. Hingegen sind die einstigen Ortsgemeinden des Kantons Thurgau eingeschlossen. Als aktive Gemeindewappen sind auch die der beschlossenen, aber noch nicht umgesetzten Fusionen enthalten, sofern bereits über ein neues Wappen abgestimmt wurde. Falls Kanton, Bezirk und Gemeinde dasselbe Wappen führen, ist es nur einmal erfasst.(Hans Rüegg)
Struttura degli stemmi e gerarchie sociali e politiche a Pisa e a Firenze (ss. XIII-1350) - Un approccio statistico - Alessandro Savorelli
Nell'arco del primo secolo dell’araldica nella Toscana settentrionale non si notano vistose variazioni nella frequenza e nel numero delle figure impiegate: le figure, su qualche centinaio di stemmi riferibili al periodo indicato, sono un numero ristretto e relativamente stabile. Un significativo mutamento avviene invece nella disposizione o “impaginazione” delle figure stesse all’interno dello scudo. Calcoli statistici mostrano una variazione costante – e simmetrica allé gerarchie sociali – nella struttura dello scudo, con una iniziale preminenza di partizioni e pezze multiple, rispetto alle pezze e alle figure semplici (o caricate e accompagnate). Questa variazione è sorprendentemente regolare e la si può osservare in relazione simmetrica al variare dei gruppi sociali (aristocrazia, borghesia più antica e ricca, media borghesia) a Firenze e a Pisa. Non possiamo indicare una o più cause precise del fenomeno: si può supporre tuttavia che la causa non stia nell'aumento del numero degli stemmi e delle famiglie che ne facevano uso. Un’ipotesi sulle motivazioni di questo fenomeno guarda piuttosto al passaggio tra funzionalità-visibilità dell’araldica militare delle origini e una sua percezione progressivamente solo identitaria.(Alessandro Savorelli)
Heraldische Sehenswürdigkeiten in der Johanniterkomturei in Fribourg - Pierre Zwick
Die Johanniterkomturei in Fribourg war kürzlich Gegenstand wichtiger Restaurationsarbeiten. Hierbei verdienen auch einige instandgestellte heraldische Objekte entsprechende Aufmerksamkeit. Die Johanniter sind in Fribourg schon 1224 präsent und bereits 1259 überliess der Rat von Fribourg den Brüdern des Ordens ein Gebiet am Ufer der Sarine, um dort ein Kloster, einen Friedhof und ein Armenspital zu bauen. Mit Pierre d’Englisberg, (ca. 1475-1545) erlebte die Komturei einen rasend schnellen Aufschwung. Mit den von ihm errichteten Bauten und Kunstwerken wollte er demonstrieren, dass er sich auf Augenhöhe mit den Autoritäten von Fribourg befand und problemlos mit dem geistigen Angebot der Stiftskirche konkurrenzieren konnte. Sein Wappen findet sich allenthalben, beispielsweise auf dem Schlussstein des Hauptportals, konstruiert gegen 1504. Etwas Besonderes ist das Ordenswappen in der Allianz mit dem Wappen des Bonaventure François, datiert 1619. Das Ordenswappen wird hier von einer Krone überhöht, obwohl eine solche normalerweise Zeichen eines Souveräns und nicht einer religiösen Ordensgemeinschaft oder eines Ritterordens ist. Es scheint, Bonaventure François reklamierte damit im Sinne einer « freien Stadt » gegenüber den Autoritäten von Fribourg den extraterritorialen Status seiner Komturei.(Rolf Kälin)
2016
Das Wappen der Barrelet von Boveresse - Louis Barrelet
Die Barrelet von Boveresse, Kirchgemeindemitglieder von Môtiers schon vor 1423, brachten einige Gerichts-vorsteher im Val-de-Travers und im Waadtland hervor. Heraldische Dokumente sind schon im 16. Jahr-hundert bezeugt und ab dem Ende des Hauses Orléans-Longueville zeigt das Hauptwappen der Barrelet in Blau ein gestürztes goldenes lateinisches Kreuz, über-höht von zwei goldenen Zirkeln, gleichfalls für die ältere und die jüngere Linie. Das Wappen «In Silber ein blauer Schräglinksbalken mit einem goldenen fünfstrahligen Stern und nach der Figur begleitet von sechs roten Rosen (3,3)» wurde von den Barlet von Bex, vormalig Barrelet von Boveresse, ab 1630 geführt. Die anderen Wappen sind vor allem persönliche. Wappen mit Zirkel und Fässchen gleichnamiger Familien oder nahestehender Barillier und Barrellet aus der Franche-Comté sind vor allem redend.(Rolf Kälin)
Der Berliner Historiker Friedrich Rühs (1781-1820) und seine Bedeutung für die Heraldik - Ludwig Biewer
Friedrich Rühs entstammte einer angesehenen Greifswalder Familie. In seiner Heimatstadt studierte er und verbrachte bis 1810 die ersten erfolgreichen Jahre seines akademischen Berufslebens. Unterbrochen wurde diese Zeit an der Ostsee von Studien in Göttingen, wo der junge Historiker von dem einflussreichsten Fachvertreter jener Zeit, August Ludwig Schlözer, 1800 promoviert und 1801 auch zur Habilitation geführt wurde. 1802 folgte die Umhabilitation in Greifswald, wo er dann auch Geschichte lehrte, ab 1808 als außerordentlicher Professor. Schon früh wandte sich Rühs der nordischen Geschichte zu und veröffentliche die ersten grundlegenden Darstellungen zur Geschichte ganz Skandinaviens (1801), dann Schwedens (5 Bände 1803-1814) und Finnlands (1809). 1810 wurde er als erster und zunächst einziger Ordinarius des Faches Geschichte an die in diesem Jahr neugegründete Berliner Universität berufen. Schon 1811 erschien Rühs‘ „Entwurf einer Propädeutik des historischen Studiums“, das noch heute lesenswert ist. Es beruht auf seinen Lehrerfahrungen und war ausdrücklich für Studenten bestimmt. Darin widmet er der Heraldik zwar nur recht wenig Raum, definiert aber zunächst diese Hilfswissenschaft griffig ganz im modernen Sinn und schreibt dann über die Herolde, die Schildformen, die Tinkturen und die Beizeichen, liefert also für den Beginn des 19. Jahrhunderts eine verlässliche Einführung in die Heraldik. Rühs gehörte zu den Wegbereitern der Heraldik und der übrigen Historischen Hilfswissenschaften. Neben engagiertem Einsatz in der Lehre veröffentlichte er in wenigen Jahren über zwanzig Bücher und zahlreiche Aufsätze. Friedrich Rühs starb auf einer Forschungs- und Erholungsreise durch Italien in Florenz.(Ludwig Biewer)
Die Vögte des Augustiner-Chorherren-Stiftes Embrach und ihre Verstädterung in Winterthur und Klein-Basel - Horst Boxler
Zu den Vögten des Augustiner-Chorherrenstifts in Embrach ZH sind zu Beginn des 20. Jahrhunderts einige wegweisende Artikel erschienen, eine moderne Wertung brachte jedoch erst Hans Baer in seiner Geschichte der Gemeinde Embrach von den Anfängen bis zur Französischen Revolution aus dem Jahr 1994. Doch nicht nur ihr Wirken am Ort und im Dienste des örtlichen Propstes und seines Konvents ist das Thema dieser Veröffentlichung, sondern gerade die Verästelung der Familie in der ministerialen Adelsgruppe, wie sie im Gefolge der Stauferherrschaft im 11. bis 13. Jahrhundert entstanden ist, um jedoch schon anfangs des 14. Jahrhunderts mit wenigen Ausnahmen zu großen Teilen wieder in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. So gilt dies auch für die Embracher Vogtsfamilie der Bochsler, die das übliche Schicksal ihrer Standesgenossen teilte und deren Vertreter sich schon Mitte des 13. Jahrhunderts nach Winterthur und wenig später nach Klein-Basel orientierten. Einzig die Erbtochter aus dritter Generation heiratete in eine in der Neuzeit auch in den Grafenstand erhobene Familie ein, die also den Aufstieg der Wenigen erreichen konnte. Besonders spannend ist auch die Erkenntnis, in welch engem Umfeld mit den Barden des Codex Manesse sich die Familie und die ihr verschwägerten Geschlechter bewegten, über die vermeintliche Kleinstaaterei der Zeit hinausgehende kulturelle Protagonisten eines der großartigsten Zeugnisse deutschsprachiger Dichtung. Im folgenden, zweiten Teil soll auf eben jene Abwanderung in die Städte berichtet werden.(Horst Boxler)
Sichtbare Hausgeschichten - Wappen an und in Zuger Häusern - Stephen Doswald und Brigitte Moser
Geht man durch die Strassen der Altstadt von Zug und nimmt sich Zeit, die Häuser zu betrachten, wird man sie mannigfaltig erblicken: Familienwappen, die an Hausfassaden oder unter Dächern angebracht sind. In den Häusern selbst finden sie sich an den Konstruktionsteilen oder der Ausstattung wieder. Diese Embleme einstiger (teils auch heutiger) Besitzerfamilien illustrieren ein Stück Besitzer- und somit Hausgeschichte, die dann lebendig wird, wenn es gelingt diese zu entschlüsseln. Bei zwei ausgewählten Profanbauten in der Zuger Altstadt lässt sich exemplarisch zeigen, wie eng die bis heute bestehenden (oder einstmals vorhandenen) Familienwappen mit der Hausgeschichte verknüpft sind.(Stephen Doswald und Brigitte Moser)
Das Wappen der Familie de Rumine - Pierre-Yves Favez
Im Jahre 1862 wurde der Familie de Rumine, obwohl damals nur gerade an die dreissig Jahre in der Stadt Lausanne ansässig, das Ehrenbügerrecht erteilt. Dies aufgrund der Grosszügigkeit der Familie auf diversen Gebieten, insbesondere im sozialen und kulturellen Bereich. Noch heute erinnern ein Strassenname und ein Palais an die wichtige Rolle, die die Familie für die Bevölkerung von Lausanne gespielt hat. Die Familie de Rumine, ihr Leben und Wirken, ist Thema der vor-liegenden Arbeit, wobei auch das Wappen der Familie vorgestellt wird. Erstmals taucht ein solches allerdings offenbar erst 1858 auf. Es findet sich, zusammen mit der Devise der Familie, auf einem Dokument, welches im Kantonsarchiv des Kantons Waadt aufbewahrt wird. 2005 wurden dem Historischen Museum Lausanne aus Privatbesitz vier Messer mit wappenbesetztem Schaft zum Ankauf angeboten, dessen ursprünglicher Besitz aufgrund des identischen Wappens nun Cathe-rine de Rumine, geb. Schahovskoy, zugewiesen werden konnte. (Rolf Kälin)
Frühneuzeitliche Neuenburger Glasgemälde im Museum für Kunst und Ge-schichte von Neuenburg - Rolf Hasler
Der Artikel behandelt die im Museum für Kunst und Geschichte erhaltenen Wappenscheiben aus der Region Neuenburg. Ausser den Originalwerken des 16. und 17. Jahrhunderts kommen dabei ebenfalls die nach solchen geschaffenen neuzeitlichen Kopien zur Sprache. Die betreffenden Glasgemälde wurden bislang mit einer Ausnahme noch nie eingehender untersucht. Es erstaunt deshalb nicht, dass es in der Forschungsliteratur dazu die eine oder andere Angabe gibt, die sich bei näherer Betrachtung als falsch erweist. Hauptgrundlage für den vorliegenden Artikel bildeten die im Museum durchgeführte Bestandsaufnahme der Glasgemälde und die Durchsicht der dortigen Inventare. Dadurch war es möglich, einige derartige Irrtümer zu korrigieren. Zu erwähnen sind diesbezüglich insbesondere die Angaben zum Wappen von Henri II d’Orléans-Longueville in dessen 1615 ins Neuenburger Schützenhaus gestifteten Scheibe (Nr. 2) und zur Datierung der Bannerträgerscheibe von Le Landeron (Nr. 5). (Rolf Hasler)
Das Wappenbuch der Schweizerischen Heraldischen Gesellschaft aus der Gründungszeit - Rolf Kälin
In den 1930er Jahren initiierte unser damaliges Mitglied Paul Boesch die Schaffung eines Wappenbuchs für die Mitglieder der Schweizerische Heraldischen Gesellschaft, in selbiges er im Jahre 1932 dann mit den ersten Eintragungen begann. Dieses Wappenbuch wird bis heute regelmässig nachgeführt. Was hingegen die wenigsten Mitglieder und Freunde der Gesellschaft wissen ist, dass bereits zur Gründungszeit der Gesellschaft im Jahre 1891 ein erstes Wappenbuch begonnen wurde, welches nun mit diesem Aufsatz erstmals publiziert wird. Das genaue Entstehungsdatum kann nicht eruiert werden, ebensowenig das Datum des letzten Eintrages. Wir müssen annehmen, dass es bereits im Gründungsjahr 1891 in Angriff genommen wurde und die Eintragungen sich über einen Zeitraum von ca. 30 Jahren erstreckten. Leider wurde es nicht vervollständigt, was aus heutiger Sicht sicher zu bedauern ist. Auch handelt es sich um eine unvollständige fakultative Erfassung von Wappen der Gründungs- und Neumitglieder. Das Wappenbuch besteht aus gesamthaft noch 39 Blättern, denn ein Blatt wurde erkennbar entfernt. Die Eintragungen sind davon allerdings nicht betroffen. Von diesen 39 Blättern sind insgesamt 24 beschrieben, respektive 22 mit Wappeneintragungen oder dafür vorgesehenen Schildkonturen versehen. Wir zählen insgesamt 64 vollständig ausgeführte Wappen, welche häufig von den Mitgliedern selbst, aber auch von anderen Wappenkünstlern der Gesellschaft eingetragen wurden, erkennbar an den jeweiligen Signaturen. Trotz der Unvollständigkeit und diverser Lücken ist das Wappenbuch ein überaus wertvolles Zeitzeugnis aus den Anfängen der Gesellschaft.(Rolf Kälin)
Das Fridolin-Wappen - Rolf Kamm
Das Glarner Wappen ist das einzige Kantonswappen mit einem Menschen drauf, dem Heiligen Fridolin. Ein Heiliger auf dem Wappen eines traditionell eher reformierten Kantons überrascht, und das Wappen ist heraldisch falsch. Wie kommt Glarus zu diesem Hoheitszeichen?
Glarus verdankt seinen Landespatron dem Kloster Säckingen. Der Legende nach soll Fridolin um 500 am Hochrhein dieses Kloster gegründet haben, das später im Glarnerland einigen Grundbesitz besass. Da das Kloster 1272 vollständig niederbrannte, stammen die ältesten eindeutigen Fridolin-Darstellungen aus Glarus: Wir finden Fridolin 1277 auf dem Siegel eines Glarner Leutpriesters und ab 1393 auf den Siegeln des Landes Glarus. Fridolin wird dort als Mönch mit Pilgerstab und Tasche dargestellt. Um 1400 entsteht die älteste erhaltene Fridolin-Fahne: Der Heilige ist schwarz gekleidet und steht auf rotem Grund. Wahrscheinlich geht die rote Farbe auf das Blutbanner des Reiches zurück, das den Glarnern im 13. oder 14. Jahrhundert vielleicht verliehen worden war. Das erste Fridolin-Wappen stammt dagegen erst aus dem 15. Jahrhundert, ist also aus Siegelbildern und Fahnen heraus entstanden.
Künftig änderte sich an der Grundfarbe nichts mehr. In der Darstellung des Heiligen herrschte aber grosse künstlerische Freiheit und bis ins 20. Jahrhundert existierten mehrere Fridolin-Versionen nebeneinander. Das änderte sich erst 1958, durch sanften Druck der Bundeskanzlei und Dank des Engagements des Glarner Kantonsarchivars. Mit Ernst Keller fand man zudem einen anerkannten Grafiker, der sich der Aufgabe annahm. Weil man sich über die Farbe von Fridolins Tasche nicht einig wurde, liess man dieses Attribut schliesslich weg. Seit 1960 hat Glarus ein offizielles Wappen von hoher grafischer Qualität.(Rolf Kamm)
Glarus verdankt seinen Landespatron dem Kloster Säckingen. Der Legende nach soll Fridolin um 500 am Hochrhein dieses Kloster gegründet haben, das später im Glarnerland einigen Grundbesitz besass. Da das Kloster 1272 vollständig niederbrannte, stammen die ältesten eindeutigen Fridolin-Darstellungen aus Glarus: Wir finden Fridolin 1277 auf dem Siegel eines Glarner Leutpriesters und ab 1393 auf den Siegeln des Landes Glarus. Fridolin wird dort als Mönch mit Pilgerstab und Tasche dargestellt. Um 1400 entsteht die älteste erhaltene Fridolin-Fahne: Der Heilige ist schwarz gekleidet und steht auf rotem Grund. Wahrscheinlich geht die rote Farbe auf das Blutbanner des Reiches zurück, das den Glarnern im 13. oder 14. Jahrhundert vielleicht verliehen worden war. Das erste Fridolin-Wappen stammt dagegen erst aus dem 15. Jahrhundert, ist also aus Siegelbildern und Fahnen heraus entstanden.
Künftig änderte sich an der Grundfarbe nichts mehr. In der Darstellung des Heiligen herrschte aber grosse künstlerische Freiheit und bis ins 20. Jahrhundert existierten mehrere Fridolin-Versionen nebeneinander. Das änderte sich erst 1958, durch sanften Druck der Bundeskanzlei und Dank des Engagements des Glarner Kantonsarchivars. Mit Ernst Keller fand man zudem einen anerkannten Grafiker, der sich der Aufgabe annahm. Weil man sich über die Farbe von Fridolins Tasche nicht einig wurde, liess man dieses Attribut schliesslich weg. Seit 1960 hat Glarus ein offizielles Wappen von hoher grafischer Qualität.(Rolf Kamm)
Chinesisches Porzellan und Perlmuttspielmarken mit Schweizer Familien-wappen, 1740–1780 - Vincent Lieber
Die vorliegende Arbeit präsentiert eine Auswahl von Ausstellungsstücken des Historischen Museums Nyon anlässlich der aktuellen von Mai bis Oktober 2016 stattfindenden Ausstellung. Diese widmet sich mit Schweizer Familienwappen verziertem importiertem chinesischem oder in der Schweiz hergestelltem Porzellan des 18. Jahrhunderts, sowie ebenfalls mit Wappen versehenen Objekten aus Perlmutt.(G. Cassina, Übers. R. Kälin)
Heraldica Lumneziana - Wappenfresken in der Kapelle St. Sebastian und St. Rochus in Vella - Aluis Maissen
Auf dem Dorfplatz in Vella/Graubünden befindet sich die 1592 geweihte Kapelle St. Sebastian und St. Rochus. Die Nord- und Südwand des Schiffes zeigen 400 Jahre alte Wappenfresken und auf dem gotischen Flügelaltar und dem Chorbogen befinden weitere Wappen, die in Öl auf Holz ausgeführt wurden. Die heraldischen Embleme wurden bisher nur rudimentär behandelt und noch nie publiziert. Ziel dieses Beitrags war es, die Wappen professionell zu beschreiben und so weit wie möglich zuzuordnen. Es muss erwähnt werden, dass die Wappenfresken und die Kunstbilder früher mit Kalk überstrichen worden waren. Bei der Restauration von 1939/40 wurden sie wieder frei gelegt. Die Kapelle ist eine Stiftung des Landrichters Gallus von Mont des Älteren und wurde vermutlich bereits 1587 gebaut, jedoch erst 1592 vom Churer Fürstbischof Peter Raschèr geweiht. Es war zur Zeit der schrecklichen Pestepidemie, die 1584 und 1585 in den Drei Bünden wütete.(Aluis Maissen)
Im Zeichen von Repräsentation und Legitimation - Der Wappenfries der eidgenössischen Landvögte im Schloss Frauenfeld - Peter Niederhäuser
Im sogenannten Gerichts- oder Tagsatzungssaal von Schloss Frauenfeld findet sich ein umfangreicher Wappenzyklus, der die Wappen der eidgenössischen Landvögte von 1462 bis 1700 zeigt und nach den sieben regierenden Orten (ohne Bern) gegliedert ist. Da sich im Raum unterschiedliche Malereien ab der Mitte des 16. Jahrhunderts finden, wurde dieser Fries bisher ganz verschieden datiert. Jetzt lässt sich der Zyklus zeitlich genau eingrenzen: Die Abrechnung des eidgenössischen Landvogts Johann Kaspar Hirzel 1658/59 verweist auf umfangreiche Baumassnahmen. Dabei wurden unter anderem Wappen an fünf verschiedenen Orten im und am Schloss erneuert, darunter in der «grossen Stube».
Die besonderen Umstände legen es nahe, diese «Erneuerung» als eine einheitliche Neugestaltung zu sehen, die durchaus zum Selbstverständnis der eidgenössischen Herrschaft wie der Landvögte passt. Der Wappenfries lässt sich nämlich auch als Antwort auf besondere politische Umstände lesen. Nachdem die eidgenössischen Orte im Herbst 1460 den Thurgau besetzt und schrittweise die Stadt Konstanz verdrängt hatten, erwarben sie Schloss Frauenfeld 1534 als repräsentativen Sitz eines Landvogtes. Die eidgenössische Herrschaft im konfessionell gespaltenen Thurgau blieb jedoch durchlässig, von strukturellen Defiziten geprägt und beschränkte sich weitgehend auf hoheitliche Kompetenzen, in erster Linie auf die hohe Gerichtsbarkeit. Die Bemühungen um eine heraldische Selbstdarstellung dürften dazu gedient haben, das alte Herkommen und das politische Gewicht der Landvogtei zu betonen und die eidgenössische Herrschaft augenscheinlich zu legitimieren.(Peter Niederhäuser)
Die besonderen Umstände legen es nahe, diese «Erneuerung» als eine einheitliche Neugestaltung zu sehen, die durchaus zum Selbstverständnis der eidgenössischen Herrschaft wie der Landvögte passt. Der Wappenfries lässt sich nämlich auch als Antwort auf besondere politische Umstände lesen. Nachdem die eidgenössischen Orte im Herbst 1460 den Thurgau besetzt und schrittweise die Stadt Konstanz verdrängt hatten, erwarben sie Schloss Frauenfeld 1534 als repräsentativen Sitz eines Landvogtes. Die eidgenössische Herrschaft im konfessionell gespaltenen Thurgau blieb jedoch durchlässig, von strukturellen Defiziten geprägt und beschränkte sich weitgehend auf hoheitliche Kompetenzen, in erster Linie auf die hohe Gerichtsbarkeit. Die Bemühungen um eine heraldische Selbstdarstellung dürften dazu gedient haben, das alte Herkommen und das politische Gewicht der Landvogtei zu betonen und die eidgenössische Herrschaft augenscheinlich zu legitimieren.(Peter Niederhäuser)
Sull’araldica della Dominazione Francese nel ducato di Milano - Gianfranco Rocculi
Quattro reperti e la loro disanima si aggiungono ad altri già riportati nell’articolo L’Araldica della Dominazione Francese nel Ducato di Milano, redatto dall’autore allo scopo di dare vita a un corpus araldico relativo al lasso di tempo corrispondente a tale dominazione, cioè ai primi decenni del Cinquecento. Due di essi sono stati rinvenuti nel castello visconteo di Fontaneto d’Agogna, il terzo nel Museo di Santa Giulia di Brescia e il quar-to nella Chiesa del Santo Crocefisso di Bodio Lomnago. I segni araldici contenuti nelle iconografie rinvenute si rivelano un apporto utile ad ampliare lo stato attuale delle conoscenze, a dare corpo con precisione alle dimensioni dell’effimera presenza francese nel paesaggio antropizzato lombardo nonché ad approfondire la conoscenza di uomini che ai tempi ne hanno favorito la realizzazione. Alla luce del ritrovamento del prototipo relativamente integro avvenuto nel castello di Fontaneto è stato possibile, inoltre, rivedere l’interpretazione del coevo stemma nel castello di Vigevano. Tali ritrovamenti lascerebbero supporre che altre testimonianze araldiche relative allo stesso quadro storico possano sopravvivere, ancora sconosciute, in diversi luoghi periferici, preziose per fornire nuovi elementi utili all’indagine e all’approfondimento delle contestualizzazioni della committenza francese.(Gianfranco Rocculi)
Fusionswappen - Problemfall oder eine neue Wappenkategorie? - Hans Rüegg
Der Autor sammelt systematisch die Wappen aller Schweizer Gemeinden, zuerst politisch geordnet, später auch nach Motiven. Wünschenswert ist eine Klassifikation nach der Motivation unter Beachtung der Prioritäten. Beispiel: Die Gemeinde Greyerz bestätigte 1941 das gräfliche Wappen, welches sie schon von alters her geführt hatte. Es wird der Kategorie „Übernommenen Adelswappen“ zugewiesen und nicht der Kategorie „Redende Wappen“ oder „Wappen mit Beziehungen zur lokalen Flora und Fauna“. Vorgesehen war auch eine eigene Kategorie „Fusionswappen“. Bei Fusionen wird jedes Motiv gemäss dem ur-sprünglichen Wappen eingeordnet. Viele Wappen enthalten aber bereits bei ihrer Entstehung mehr als ein Symbol, die bei den betreffenden Kategorien einzuordnen sind. Somit gibt es keinen Grund, für die Fusi-onen eine eigene zu führen, obwohl die Fusion Auslöser ist.
Die bekannteste Wappenverbindung ist das Wappen des Kantons Graubünden, das erst 1932 genehmigt wurde. Bei Gemeinden datieren die ersten Fusionen mit Wappenverbindungen ab 1961. Der Nachteil dieser Wappenverbindungen besteht darin, dass sie die Aussagestärke und optische Wirkung der bisherigen Wappen nicht erreichen. Eine Arbeit des Autors über die Dorfwappen im Kanton Zürich brachte die Erkenntnis, dass viele Dörfer oder Gemeindeteile eigene Wappen und Fahnen besitzen. Die Wappen fusionierter Gemeinden verlieren den offiziellen Status, sollen aber weiterhin als Dorfwappen verwendet werden. Eine weitere Unterkategorie der Fusionswappen sind solche mit Motiven, die eine Zählfunktion ausüben. Das bekannteste Beispiel ist das Wappen des Kantons Wallis. Da der Stern zu oft als Zählfunktion herhalten muss, wirkt diese Art abgedroschen. Häufiger treten andere Motive auf. Eigentliche Neu-schöpfungen mit neuen Motiven, die den Ansprüchen an ein gutes Wappen genügen, sind rar.(Hans Rüegg)
Die bekannteste Wappenverbindung ist das Wappen des Kantons Graubünden, das erst 1932 genehmigt wurde. Bei Gemeinden datieren die ersten Fusionen mit Wappenverbindungen ab 1961. Der Nachteil dieser Wappenverbindungen besteht darin, dass sie die Aussagestärke und optische Wirkung der bisherigen Wappen nicht erreichen. Eine Arbeit des Autors über die Dorfwappen im Kanton Zürich brachte die Erkenntnis, dass viele Dörfer oder Gemeindeteile eigene Wappen und Fahnen besitzen. Die Wappen fusionierter Gemeinden verlieren den offiziellen Status, sollen aber weiterhin als Dorfwappen verwendet werden. Eine weitere Unterkategorie der Fusionswappen sind solche mit Motiven, die eine Zählfunktion ausüben. Das bekannteste Beispiel ist das Wappen des Kantons Wallis. Da der Stern zu oft als Zählfunktion herhalten muss, wirkt diese Art abgedroschen. Häufiger treten andere Motive auf. Eigentliche Neu-schöpfungen mit neuen Motiven, die den Ansprüchen an ein gutes Wappen genügen, sind rar.(Hans Rüegg)
Manuskripte in der Sammlung der Gesellschaftsbibliothek - Sabine Sille
Oftmals kann ein Umzug verborgene Schätze hervorbringen. So geschehen, als die Gesellschaftsbibliothek der Schweizerischen Heraldischen Gesellschaft von Fribourg nach Neuenburg umziehen musste. Nach der Räumung der Bibliotheksregale in der Universitätsbibliothek in Fribourg wurde ein Karton mit „Schriften oder Publikationen“ gefunden, der der Gesellschaft gehörte. Darin befanden sich 22 Manuskripte des 16. bis 19. Jahrhunderts, handgeschriebene Dokumente auf Pergament. Es sind dies Nobilitierungen, Adelsbriefe, Freiherrendiplome, Wappenbriefe, Adelsdiplome sowie Erhebungen in den Adels- oder Ritterstand. Sie datieren zwischen 1558 und 1812. Diese Dokumente auf Pergament sind mit kolorierten Wappen versehen, in Seidensamt gebunden und tragen teils angehängte, schwere Siegel in Schatullen aus Holz oder vergoldetem Messing. Einige dieser Dokumente werde nun hier vorgestellt. Von den 22 Dokumenten wurden fünf verschiedene Manuskripte ausgesucht, die unterschiedliche Prädikate aufzeigen. So wurden ein Wappenbrief, ein Adelsdiplom, eine Erhebung in den Ritterstand, ein Freiherrendiplom und ein Adelsbrief post mortem ausgewählt. (Sabine Sille)
Glasmaler Hans Drenckhahn – Portrait eines wiederentdeckten Heraldikers - Patricia Sulser
Trotz seiner wichtigen und guten Arbeit geriet Glasmaler und Heraldiker Hans Drenckhahn nach seinem Tod im Jahre 1953 weitgehend in Vergessenheit. Sein Nachlass befindet sich zu einem großen Teil als „Fond Hans Drenckhahn“ im Vitrocentre Romont. Die Meisten Werke sind signiert und datiert, was einen detaillierten Einblick in sein Werk, seine Arbeitsweise und sein Leben ermöglicht. Schon vor der Bearbeitung des Nachlasses erschien sein Name zwar in verschiedenen Publikationen, jedoch war es bis anhin nicht möglich seine Arbeit in einen Kontext zu stellen, da nichts weiter als sein Name und Alter bekannt war. Der Nachlass erlaubt es aber, einen spannenden Künstler und Heraldiker wieder aufleben zu lassen. So zeigt sich, dass der 1878 geborene Hans Drenckhahn in die Fußstapfen seines Vaters trat und bei ihm sein Handwerk erlernte. Er avancierte zu einem erfolgreichen Glasmaler, Restaurator und Heraldiker. In diesem Artikel wird sein Portrait dargestellt, wie es sich aus seinem Nachlass erschließen lässt. Ohne Frage gibt es auch weiterhin im Nachlass dieses Künstlers, sowohl in der Heraldik wie auch in der Glasmalerei, noch viel zuzuordnen und zu entdecken. An Hans Drenckhahns Nachlass sieht man nicht nur wie umfangreich sein Schaffen gewesen sein musste sondern auch wie sehr die Glasmalerei mit der Heraldik verwoben ist.(Patricia Sulser)
Über das Chorgestühl des Ordens vom Goldenen Vlies in der Sainte-Chapelle von Dijon - Jean Vaivre
In Dijon wurde Ende des 12. Jahrhunderts eine Stifts-kirche errichtet, an der sich die Arbeiten sehr zögerlich und bis ins 16. Jahrhundert fortsetzten. Sie diente zuerst den Kirchgemeindebedürfnissen am Palast von Dijon. Mit der Konstituierung des Ordens vom Goldenen Vlies, eingeführt von Philipp dem Guten anlässlich seiner Hochzeit mit Isabelle von Portugal in Brügge im Jahre 1430, kam die Palastkapelle zu einem Statuswechsel und zu neuem Glanz. Eines der markantesten Elemente des neuen Dekors bestand aus einer Serie von prächtigen mit Wappen versehenen Chorstühlen. Der Autor interessiert sich in erster Linie für die Frage dieses heraldischen Dekors in Verbindung mit dem Orden vom Goldenen Vlies. Die Zerstörung der Sainte-Chapelle von Dijon und die Zerstreuung des Mobiliars während der Revolution (1794) haben uns ein Ensemble vorenthalten, welches ein aussergewöhnliches Zeugnis über die Geschichte dieses glanzvollen Ordens abgegeben hätte. Die über den Chorstühlen der Liebfrauenkirche von Brügge aufbewahrten Malereien, die im Burgund wiedergefundenen fragmentarischen Reste, und ihr Vergleich mit den drei im Museum Senderlin von Saint-Omer aufbewahrten schönen Wappentafeln tragen jedoch dazu bei, uns eine Vorstellung auf das sich einst am Sitz des Ordens in der Sainte-Chapelle von Dijon befindende Dekor wo die festlichen Zeremonien von statten gegangen waren zu geben, was einem willkommenen Anreiz einer virtuellen Wiederherstellung in der ehemaligen Hauptstadt der Herzöge von Burgund gleichkommt.(G. Cassina, Übers. R. Kälin)
Wappen im Kanton Bern - Berchtold Weber
Wie im ganzen Abendland hatte zur Zeit der Gründung der Stadt Bern, 1191, jeder Adelige bereits ein Wappen. Aber schon im 13. Jahrhundert nahmen massgebende Bürger der Stadt selber ein Wappen an. Schon damals gab es redende wie auch Bilderrätsel- (Rebus-) Wappen. Erste Zusammenstellungen von Familienwappen datieren aus dem späten 16. Jahrhundert. Einen entscheidenden Einfluss auf Wappen-darstellungen auf dem Lande übte das 1601 geschaffene Zähringerdenkmal im Berner Münster aus. Im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts lässt sich der Übergang von Schild mit Helm und Helmzier zum Wappenmedaillon mit Rangkrone verfolgen. Seit dem 18. Jahrhundert konnte sich der Mann vom Lande wohlfeil ein Wappen auf einer der damals aufkommenden Schliffscheiben zulegen. Neu gegründete Ufficine araldice (heraldische Werkstätten) in Mailand machten sich das zunutze und belieferten im Verlagssystem vor allem die bernische Landbevölkerung mit Wappen. Das in der Zeit des Historismus neu erwachte Interesse an der Heraldik fand vor allem zusammen mit der Heimatschutzbewegung ein reiches Betätigungsfeld. Es führte auf eidgenössischer Ebene nicht nur zum gesetzlichen Schutz der Kantons- und Gemeindewappen, sondern im Kanton Bern auch zur Herausgabe von Wappenbüchern.(Berchtold Weber)
Deus spes nostra est – Zur Herkunft und Verwendung des Schaffhauser Wahlspruchs - Hans Ulrich Wipf
Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, wann und auf welche Weise der bis heute geläufige Schaffhauser Wahlspruch Deus spes nostra est (Gott ist unsere Hoffnung) entstanden ist und wo überall er durch die Jahrhunderte hindurch verwendet wurde. Sein erstes Auftreten lässt sich klar auf eine Münzprägung im Jahre 1550 zurückführen. Seitdem trat er als obligate Begleitung des Schaffhauser Standeswappens an den verschiedensten Orten und Gegenständen auf, so beispielsweise auf Kirchenglocken, an und in öffentlichen Gebäuden, auf Gegenständen des Kunsthandwerks und der Kunst wie auch in festlichen Reden.(Hans Ulrich Wipf)